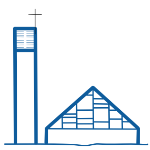Lk 19, 1-10: Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch: Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können –denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: „Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“ Der stieg sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: „Er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist!“ Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: „Herr, sieh doch: Die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams! Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.“ (Übersetzung: Basisbibel)
Liebe Mitchristen!
Mich lassen die Bilder nicht los, die in den letzten Tagen um die Welt gegangen sind. Der wohl elendste Ort in Europa wurde ein Raub der Flammen, das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. 12 000 Menschen wurden obdachlos. 5 Tage danach leben die meisten von ihnen immer noch auf der Straße, unversorgt und ohne Schutz. Es ist unerträglich. Und es ist beschämend, dass sich diese erschütternde Katastrophe hier bei uns in Europa abspielt, im christlichen Abendland. Wir alle wissen, was wir als Christen hier zu tun hätten. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan.“ So sagt es uns Jesus in Matthäus 25. Und er sagt auch: „Was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt.“
Die leitenden Geistlichen der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) schreiben in ihrem gemeinsamen Appell: „Es muss endlich gehandelt werden. Wir bitten die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, umgehend eine europäische Lösung für die Verteilung der Schutzsuchenden auf aufnahmebereite Länder zu finden. Wir erwarten vom Bundesminister des Innern, sich den Angeboten von Bundesländern und Kommunen, Geflüchtete aus den griechischen Lagern aufzunehmen, nicht länger zu widersetzen. Unsere Unterstützung sagen wir zu.“
Geflüchtete Menschen müssen wir aufnehmen, die an den Grenzen Europas gestrandet sind und die dort unter menschenunwürdigen Bedingungen dahinvegetieren. 12 000 sind es, allein auf Lesbos. Wie viele davon können wir aufnehmen? Was ist unsere Obergrenze? Wir alle wissen: Bei Jesus gibt es keine Obergrenze. Er war radikal. Einem reichen jungen Mann gab Jesus den Ratschlag: „Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann komm und folge mir!“ Solche Ratschläge machen uns eher ratlos als das sie uns weiterhelfen. So wie die erschütternd große Zahl an Obdachlosen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria – 12 000 Menschen. Wir wollen helfen, aber wie? So vielen? Wer kann das schaffen? Was wird dann aus uns? „Verteile alles, was du hast, an die Armen.“ Den reichen jungen Mann macht dieser Ratschlag von Jesus ratlos. Traurig geht er weg.
Aber es gibt auch andere Geschichten in der Bibel. Unser heutiger Predigttext zum Beispiel. Da ist auch ein reicher Mann. Zachäus heißt er. Er ist verstrickt in schmutzige Geschäfte – Kollaboration mit der römischen Besatzungsmacht. Als Zöllner treibt er am Stadttor die Steuern und Abgaben ein, die die Römer in ihren besetzten Gebieten erheben. Reich werden kann man dabei nur, wenn man den Leuten noch mehr abverlangt, als von oben gefordert, und damit in die eigene Tasche wirtschaftet. Zachäus ist reich geworden bei diesem schmutzigen Geschäft, sehr reich. Bis zum Oberzöllner hat er es gebracht. Glücklich gemacht hat ihn sein schmutzig erworbenes Geld nicht. Er ist einsam, hat keine Freunde. Die Menschen aus seinem eigenen Volk verachten ihn, und für die Römer bleibt er ein Fremder. Als Jesus in die Stadt kommt, steigt er deswegen auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Ein Bad in der Menge kommt für Zachäus nicht in Frage, das wäre unerträglich für ihn. Es könnte für ihn sogar gefährlich werden, so unbeliebt wie er ist. Denn körperlich ist er den Anderen nicht gewachsen. Jesus holt Zachäus raus aus seiner selbstgewählten Isolation und lädt sich bei ihm zum Essen ein. Die Menschenmenge läuft daraufhin bald auseinander. Statt Begeisterung für Jesus gibt es jetzt nur noch Kopfschütteln: „Jesus lädt sich zum Essen ein zu Jemandem, der in schmutzige Geschäfte verwickelt ist!“
Ich verstehe die Reaktion dieser Menschenmenge. Aber für mich ist es tröstlich, dass Jesus sich bei so Jemandem zum Essen einlädt. Jemand, der in schmutzige Geschäfte verwickelt ist, so wie ich, so wie wir alle hier in den reichen Ländern Europas. Wir leben in Strukturen, die Menschen in anderen Teilen der Welt ausbeuten. Strukturen, die ihren Teil dazu beitragen, dass Menschen aus diesen ärmeren Ländern ihre Heimat verlassen, weil es dort keine Zukunft mehr für sie gibt, nur Elend und Krieg. 12 000 sind es allein in Moria auf Lesbos. „„Herr, sieh doch: Die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben“, sagt Zachäus, der Jesus bei sich zu Gast hat. Die Hälfte, das ist richtig viel. Und die Menschen, die Zachäus betrogen hat, die will er auch entschädigen. Da kommt sicherlich auch noch Einiges zusammen. Sicherlich mehr, als ich mir je vorstellen könnte, von meinem Besitz abzugeben. Trotzdem: Diese Geschichte lässt mich nicht so traurig zurück wie den reichen jungen Mann, dem Jesus sagte: Verteile alles, was du hast, an die Armen. Einfach alles. Behalte nichts für dich zurück. Nehmt alle Flüchtlinge aus Moria auf, alle 12 000. Das würde mich traurig machen, traurig und ratlos. Ich würde den Mut verlieren und denken: Das schaffe ich sowieso nicht. Das können wir nicht schaffen. Dann würde ich am Ende gar nichts tun, und keinem einzigen hilfsbedürftigen Menschen wäre geholfen.
In der Geschichte von Zachäus ist es anders. Dieser Zöllner behält etwas für sich zurück, damit er sein Leben weiterleben kann. Er lebt weiter in diesen Strukturen, die auf schmutzige Geschäfte ausgelegt sind. Er versucht, das Beste daraus zu machen, den Menschen gerecht zu werden. Manche haben es anders gemacht – haben das Alte hinter sich gelassen und ein komplett neues Leben angefangen. So wie die Jünger von Jesus, die alle Sicherheiten von Beruf, Familie und Dorfgemeinschaft aufgegeben haben. Aber das Schaffen nur die Wenigsten, damals wie heute. Deswegen halte ich mich an die Geschichte von Zachäus: Er hilft den Armen und setzt sich für Gerechtigkeit ein, und behält doch auch genug für sich. Das können wir auch tun in unserer Zeit. Da ist bei uns auch noch Luft nach oben. In unserem Land ist auch noch Platz für Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria, die wir dort aus dem Elend holen können – wenn auch nicht für alle. Setzen wir uns ein für Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit, so wie es in unseren Möglichkeiten steht, im Vertrauen auf Gott, der für uns alle einen Weg weiß.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer