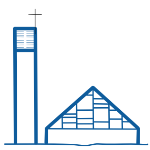Predigt zum 2. Sonntag nach Trinitatis, 29. Juni 2025
Liebe Mitchristen!
Gestern war ich mit meinem Sohn in Spaichingen im Freibad. Es war ein richtig heißer Sommertag. Beim Schwimmen im Wasser gab es Erfrischung, aber die Hitze machte auch durstig. Also nichts wie hin zum Freibad-Kiosk. Dort steht schon eine lange Schlange durstiger Menschen. Werbeschilder preisen an, was es dort alles Leckeres zu trinken gibt: Bier, Wasser, Limo, Kaffee und Eisgetränke. Endlich bin ich an der Reihe. Eine Flasche Wasser will ich kaufen. Wasser löscht den Durst am besten, finde ich. 3 € kostet die Flasche- ein stolzer Preis für einen halben Liter Wasser. Aber wir haben Durst, also kaufe ich sie.
Zurück auf der Liegewiese setzen wir uns auf unsere Badetücher und trinken das Wasser, Schluck für Schluck. Es tut gut, wie das kühle Wasser die Kehle hinunterrinnt und der Durst langsam verschwindet. Ich lese, was auf der Flasche aufgedruckt ist: „Kostbar“ steht da geschrieben. Ob diese Wasserflasche wohl deswegen so viel gekostet hat, weil es kostbares Wasser ist? Eigentlich ist Wasser immer kostbar, denke ich- nicht nur im Freibad, wo alles ein bisschen teurer ist, weil die Kioskbetreiber ja auch davon leben können müssen. Kostbares, teures Wasser ist für mich eigentlich auch kein Problem. Ich habe ja genug Geld, um es bezahlen zu können, auch wenn die kleine Flasche im Freibad etwas teurer war als sonst. Und bei mir zuhause, da wird mir das Wasser sogar frei Haus geliefert. Ich brauche nur den Wasserhahn aufzudrehen.
In den ärmeren Ländern dieser Erde ist das anders. Viele Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele müssen täglich weite Wege gehen bis zur nächsten Wasserstelle, und das Wasser mühsam nach Hause tragen. Durch die Klimaerwärmung verschärft sich dieses Problem noch, und noch mehr Menschen sind von solcher Wasserknappheit und Not betroffen. Wasserknappheit führt zu Konflikten und Kriegen. Und Kriege führen dazu, dass Menschen das Nötigste zum Leben fehlt- Wasser und Nahrung. Oder der Entzug von Wasser und Nahrung wird als Druckmittel eingesetzt in kriegerischen Auseinandersetzungen.
Wasser ist kostbar. Aber teuer sollte es nicht sein, und schon gar nicht unbezahlbar oder unerschwinglich. Denn Wasser ist ein Grundbedürfnis. Ohne Wasser sterben wir schon nach wenigen Tagen. Wasser brauchen wir zum Leben- Wasser und Nahrung. „Auf ihr Durstigen, hier gibt es Wasser! Kommt, kauft euch zu essen! Kommt und kauft ohne Geld! Wein und Milch- sie kosten nichts!“ Mit diesen Worten macht in der Bibel in Jesaja 55, 1 ein Prophet auf sich aufmerksam. Marktschreierisch und mit lauter Stimme preist er seine Waren an: Wasser, Wein und Milch gibt es an seinem Getränkestand, außerdem leckeres Essen: „Hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen!“ (Jesaja 55, 2)
Dieser marktschreierische Prophet befand sich nicht in Israel, sondern in Babylon. Aber auch dort war sicher eine Gluthitze, so dass sein Angebot sehr verlockend gewesen sein muss. Und das nicht nur für die Kundschaft mit dem dicken Geldbeutel. Mit seinem lauten Rufen wendet sich der Prophet gerade auch an die, die den halben Liter Wasser nicht bezahlen können, den sie an diesem heißen Tag so dringend bräuchten: „Kommt und kauft ohne Geld!“
Es sind die Menschen, die aus Israel stammen und die hier in Babylon in der Fremde sind, die der Prophet mit seinen Worten ansprechen will. Und diese Menschen werden aufmerksam auf ihn. Plötzlich laufen sie nicht mehr mit leeren Gesichtern und leeren Herzen aneinander vorbei. Plötzlich gibt es da mehr als den üblichen Tunnelblick und Alltagstrott. Plötzlich ist da dieser Gedanke, dieser Geistesblitz: Vielleicht kann man ja doch etwas ändern an den schlimmen Zuständen in der Welt. Vielleicht ist doch nicht alles sinnlos. Vielleicht hat Gott uns ja doch nicht vergessen. Vielleicht ist Gott wirklich für uns da. Für die Israeliten, die nach Babylon verschleppt worden waren, war das alles aus dem Blick geraten. Die erste Generation, die dort in die Fremde nach Babylon verschleppt worden war, die hatte noch die Hoffnung hochgehalten. Die hatte sich noch an den Wasserflüssen von Babylon zu Gottesdiensten versammelt, hatte geweint und gebetet und sich nach ihrer Heimat gesehnt: „An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.“ (Psalm 137, 1) Aber die Zeit verging, und mit ihr auch die alte Generation, die die Heimat noch kannte. Und so hängten die Israeliten ihre Harfen in die Weiden, und ihr Gesang verstummte.
Aber die Stimme des Propheten an seinem Marktstand verstummte nicht. Sie wurde umso lauter. Dieser Prophet lebte mit seinem Volk in Babylon im Exil. Wir nennen ihn den zweiten Jesaja. Denn mit seiner Einladung zu hören schöpfte er aus der Botschaft des früheren, des ersten Propheten Jesaja. „Hört doch auf mich!“ sagt die Stimme des zweiten Jesaja. Hört, was Gott euch sagen will: Gebt euer Geld nicht für Sinnloses aus. Investiert nicht in das, was den Tod bringt. Investiert in das Leben! „Warum wollt ihr Geld ausgeben für das, was kein Brot ist? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht?“ (Jesaja 55, 2) „Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht.“ (Jesaja 55, 3) Ich habe euch nicht vergessen, niemals. Mein Wort gilt immer und ewig. Ich lasse euch nicht im Stich. Egal, wo ihr seid. Ihr braucht keine großen und beeindruckenden Gotteshäuser, um mich anzubeten. Ich braucht keine megamäßigen Versammlungen und Großveranstaltungen. Ja, auch in der Fremde bin ich immer bei euch, auch hier in Babylon, fern von Jerusalem. Auch wenn der Jerusalemer Tempel zerstört ist und dort kein Stein mehr auf dem anderen steht. Meine Liebe zu euch ist unzerstörbar.
Das lässt die Israeliten aufhorchen, dort im fernen Babylon. Auf einmal gilt es nicht mehr, was ihnen ihre Eltern gesagt haben: Lasst uns die Vergangenheit totschweigen mit all ihren Schrecken. Auf einmal wird der Teufelskreis aufgebrochen, und das Trauma von Vertreibung und zerstörter Heimat wird nicht mehr von Generation zu Generation weitervererbt. Auf einmal ist der stumpfe Blick zu Boden wie weggewischt, und es ist ein Leuchten in ihren Augen. Vielleicht ist es nur eine kleine Veränderung, kaum wahrnehmbar. Aber der Prophet, den wir den zweiten Jesaja nennen, der merkt, was geschehen ist: „Jetzt!“ sagt er. Jetzt ist es soweit – endlich! Jetzt ist eure Sehnsucht erwacht! Jetzt habt ihr gemerkt: Es gibt noch mehr als das tägliche Sich-Abrackern für den Lebensunterhalt.
Essen und Trinken, Wasser und Brot, das brauchen wir zum Leben. Aber wir brauchen noch so viel mehr. Da gibt es einen Hunger, einen Durst nach mehr: die Sehnsucht nach Sinn, nach Erfüllung, nach Leben in Gottes Fülle. Die Sehnsucht nach Gott, der uns gewollt und geliebt hat vom allerersten Anfang unseres Lebens an. Fragt nach ihm! „Sucht den HERRN, jetzt ist er zu finden! Ruft zu ihm, jetzt ist er nahe!“ (Jesaja 55, 6).
Wir Heutigen sind gar nicht so weit weg von den Israeliten damals in Babylon. Äußerlich haben wir, was wir zum Leben brauchen, und kaum jemand von uns muss um das tägliche Brot bangen. Aber innerlich ist da oft diese große Leere, und der Glanz in unseren Augen ist verloschen. Manche tragen die Lasten vergangener Generationen mit sich herum, so wie damals die Israeliten das Trauma von Vertreibung und zerstörter Heimat. Viele machen sich Sorgen um die Zukunft in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, wo Krieg als Mittel der Politik inzwischen schon zur Normalität geworden ist- eine Normalität, an die wir als Christen uns nie gewöhnen dürfen! Andere sind schon völlig abgestumpft, oder sperren die schlechten Nachrichten aus aller Welt aus ihrem Leben aus, weil sie sie nicht mehr ertragen können. Aber Gott schenkt uns neuen Glanz in unseren Augen. Gott schärft unseren Blick für die Not unserer Mitmenschen; für Leid und Ungerechtigkeit- hier bei uns und in aller Welt. Gott stillt unseren Lebensdurst. Gott gibt uns das Brot des Lebens in Jesus Christus, seinem Sohn. Er lädt uns alle ein an seinen Tisch, damit wir die Schatten der Vergangenheit hinter uns lassen und neue Kraft tanken können für unser Leben. Denn Jesus Christus hat es uns versprochen: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch eure Last abnehmen.“ (Matthäus 11, 28)
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer