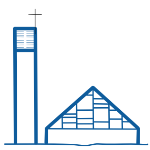Predigt zum Sonntag Rogate
Lk 11, 1-13: Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; 6denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 7und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. 8Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!
Liebe Mitchristen!
Jesus bete. Immer wieder erzählt die Bibel davon, wie Jesus sich zurückgezogen hat zum Beten. Wie er allein sein wollte mit seinem Gott. Was macht Jesus da nur, wenn er allein ist mit Gott? Wie macht er es, dass er Gottes nähe erfahren kann? Welche Worte spricht er? Oder ist es ein Gebet ohne Worte, wo er im Herzen ganz bei Gott ist- wie die Liebenden, die keine Worte mehr brauchen, um sich zu verstehen? Wenn ich das doch auch könnte, Gott so nahe zu sein. Wenn ich mich doch wirklich darauf konzentrieren könnte, zu Gott zu beten. Aber immer wieder kommen diese störenden Gedanken dazwischen: Ist da wirklich jemand, der mich hört, oder rede ich nur ins Leere, wie gegen eine Wand? Ist das nur ein Selbstgespräch, eine Selbsttäuschung? Was ändert sich schon durch mein Gebet? Kann Beten wirklich helfen? Herr, lehre uns beten, sagen die Jünger. Und Jesus erhört ihre Bitte. Er antwortet ihnen nicht irgendwie theoretisch oder abgehoben. Er gibt auch keine Anleitung, wie ich zur inneren Ruhe und Konzentration finde. Er sagt nicht: So wie ich müsst ihr es machen. Steigt auf einen Berg, wo ihr allein seid und niemand euch stört. Dort oben könnt ihr in Ruhe beten. Es braucht keinen besonderen Ort, um mit Gott reden zu können. Wenn ich einen solchen Ort für mich gefunden habe, ist es gut. Auch der Gottesdienst kann ein solcher Ort sein, wo ich zur Ruhe kommen und mich Gott zuwenden kann. Aber beten kann ich überall. Es braucht keine besonderen Voraussetzungen dazu. Auch wenn mein Kopf leer ist und meine Gedanken abschweifen kann ich beten. Ich kann beten mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. „Herr, lehre uns beten,“ sagen die Jünger. Und Jesus antwortet mit dem Vaterunser. So sollt ihr beten, sagt Jesus: „Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung.“ Das sind Worte, die uns vertraut sind. In aller Kürze hat sie der Evangelist Lukas aufgeschrieben – so kurz, dass uns hier manches fehlt von diesen vertrauten Worten. Die fehlenden Worte finden wir im Matthäusevangelium überliefert.
Es gibt wohl kaum einen anderen Bibeltext, der uns so vertraut ist wie das Vaterunser. Das Vaterunser haben wir zumeist schon als Kinder auswendig gelernt. „Herr, lehre uns beten.“ Überlegen wir mal, wo wir beten gelernt haben: War es im Kindergarten oder in der Schule, vielleicht im Konfirmandenunterricht? Waren es die Eltern oder die Großeltern, die mit mir gebetet haben? Beten ist Vertrauen. Das deutsche Wort „Vertrauen“ kommt von dem gotischen Wort „trauan“. Übersetzt heißt das „fest“ oder „stark“. Das Schwierige am Vertrauen ist, ich kann mich nicht dazu entscheiden. Vertrauen kann ich mir nicht vornehmen. Sondern: Ich muss es trainieren. Es muss wachsen. Ich stelle mir ein kleines Mädchen vor, das mit seinem Vater spielt. Sie stellt sich auf einen kleinen Tisch. Er breite seine Arme aus. Und sie springt – weil sie weiß, dass ihr Vater sie natürlich auffängt. Dann lacht sie, kreischt ein bisschen und will das gleiche Spiel noch mal und noch mal und noch mal. Dieses kleine Mädchen übt Vertrauen mit dem Vater. Später sitzt der Vater bei ihr an der Bettkante. Die beiden werden still und falten die Hände. Sie beten. Welche Worte sie dafür wohl verwenden, der Vater und seine kleine Tochter? „Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.“ Vielleicht beten sie so. Oder so, wie ich es noch aus meiner Kindheit kenne: „Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein.“ Was war Ihr Abendgebet, damals, als Sie ein Kind waren? Und haben Sie dieses Abendgebet weitergeben können an Ihre Kinder und Enkel? Herr, lehre uns beten.
Beten ist kein Reden ins Leere, kein Sprechen gegen eine Wand. Wenn ich Gott um etwas bitte, dann ist das so, wie wenn ich meinen besten Freund oder die beste Freundin um etwas bitte. Es gibt Bitten, die sind so gewagt, dass ich mich nur bei meinen allerbesten Freunden traue, sie um so etwas zu bitten. Nur die beste Freundin oder den besten Freund würde ich nachts aus dem Schlaf klingeln, wenn ich in Not bin. So wie dieser Mensch, von dem Jesus erzählt, der nachts dringend noch drei Brote braucht. Besuch hat er bekommen. Sein Freund ist von weither angereist, mit staubigen Füßen und knurrendem Magen. Er braucht dringend etwas zu Essen. Er kann nicht warten bis morgen. Unverschämt ist das, mitten in der Nacht beim Freund zu klingeln. Aber dieser Mensch tut es. Und er bekommt die drei Brote, um die er gebeten hat. „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan,“ sagt Jesus. Gebt nicht auf, euch mit euren Bitten an Gott zu wenden. Auch nicht mitten in der Nacht. Auch nicht, wenn es hoffnungslos scheint. Mitten in der Nacht von Krieg und Gewalt sollt ihr Gott um Frieden bitten. Um Frieden zwischen den Menschen und Völkern. Um Frieden für die Ukraine. Gebt nicht auf – nicht eure Hoffnung und nicht eure Gebete.
Um Brot geht es in den Geschichten, die Jesus erzählt: Drei Brote werden mitten in der Nacht gebraucht. Drei Brote, ein Fisch, ein Ei – das ist es, was wir zum Leben brauchen. Nicht die Schlangen und Skorpione brauchen wir, die das Leben zerstören. Die wollen wir unseren Kindern nicht geben, sondern das, was zum Leben dient – ein Brot, ein Gutenachtgebet, unsere offenen Arme, in die sie sich fallen lassen können. „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ So beten wir im Vaterunser. Martin Luther erklärt das im Kleinen Katechismus so: „Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.“ Unser tägliches Brot, das ist: Alles was wir zum Leben brauchen. Auch der Friede gehört dazu, ein gutes Miteinander zwischen den Menschen. „Bittet, so wird euch gegeben,“ sagt Jesus. Beten ist Vertrauen. Manchmal bete ich lange. Manchmal immer und immer wieder. Manchmal weiß ich nicht, ob ich gehört werde. Manchmal kommt alles ganz anders, als ich es erhofft und erbeten habe. Dann übe ich Vertrauen, so wie das kleine Mädchen mit seinem Vater. Ich lasse mich fallen in Gottes offene Arme. Auch wenn es da tief nach unten geht und ich nicht sicher sein kann, dass es gutgehen wird. Ich lasse mich fallen und bete: „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer