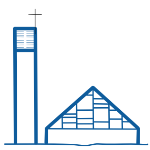Predigt zum 4. Sonntag vor der Passionszeit, 6. Februar 2022
Mt 14, 22-33: Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht! Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. 33Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!
Liebe Mitchristen!
Es stürmt. Scharf pfeift der Wind ins Gesicht. Gegenstände wirbeln durch die Luft. Die Äste der Bäume knarren und ächzen. Jesus ist auf einen Berg gestiegen. Endlich mal allein sein und abschalten. Endlich mal Zeit haben – nur für mich, nur für Gott. Jesus betet. Es ist schon Abend. Jesus will neue Kräfte schöpfen für den nächsten Tag. Heute waren über 5000 Menschen da, die Trost und Heilung brauchten: Kranke und Gesunde, vom Schicksal gebeutelte und solche, die einfach nur neugierig waren. Gottes Wort hatte er ihnen gegeben und Heilung und Brot. Es war ein langer Tag gewesen. Es war wirklich Zeit, jetzt Feierabend zu machen – für Jesus und erst recht für seine Jünger. Den Jüngern hatte Jesus schon früher Feierabend gegeben als sich selbst: „Fahrt ihr schon mal mit dem Boot voraus, bis ich die Leute hier vollends nach Hause geschickt habe,“ hatte er ihnen gesagt. „Ich komme dann später nach – am Ufer entlang.“ Eigentlich war das ein guter Plan. Wenn da nur nicht dieser Sturm gewesen wäre.
Jesus steht auf dem Berg und schaut hinunter zum See Genezareth. Die Wellen des Sees schlagen immer höher ans Ufer. Schaumkronen sind auf den Wellen des Sees, so weit das Auge blickt – bis sich das alles verliert im Dunkel der heraufziehenden Nacht. Dort unten auf dem See gibt es einen winzigen Punkt, der auf den Wellen tanzt – ein kleines Fischerboot. In dem Boot sitzen die Jünger vorn Jesus und kämpfen mit den Wellen. Sie kämpfen um ihr Leben. Sie sind in Seenot. Und Jesus ist weit weg von ihnen – dort oben auf dem Berg. Jesus macht sich Sorgen um seine Jünger: War es ein Fehler, dass er sich diese Zeit zum Alleinsein genommen hat? Hätte er bei ihnen bleiben sollen? Wird er ihnen jetzt noch helfen können? Wird Gott ihm die Kraft dazu geben? Die Sorgen treiben Jesus vom Berg, runter zum See, wo seine Jünger ihn brauchen. In tiefster Nacht erreicht er das Seeufer.
In tiefster Nacht kämpfen die Jünger auf dem See mit den Wellen. Das rettende Ufer ist nicht weit. Aber es ist unmöglich, das Ufer zu erreichen. Der Wind steht ihnen entgegen. Verzweifelt legen sie sich in die Riemen, um gegenzusteuern. Verzweifelt schöpfen sie Wasser aus dem Boot, damit es nicht sinkt. Wie lange wird das Boot dem Sturm wohl noch standhalten? Jeden Moment kann es auseinanderbrechen. Dann ist es aus. Die Jünger versuchen, nicht daran zu denken. Keiner spricht ein Wort. Verbissen machen sie weiter. Auch wenn die Hoffnung schwindet, dass sie es schaffen werden. Auch wenn sie am Ende ihrer Kräfte sind. Die Nacht ist tief. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Eine schlaflose Nacht in den Stürmen des Lebens. Wie spät ist es eigentlich? Müsste es nicht bald Morgen werden? Wird es da hinten nicht schon heller – ein Lichtblick, ein Silberstreif am Horizont? Oder ist das eher ein Nebelstreif, was da im Sturm über dem Wasser zu sehen ist? Es kommt näher, unheimlich, unentrinnbar – wie ein Alptraum, der nach den Jüngern greift in dieser schlaflosen Nacht: Jetzt ist es aus. Jetzt werden die Fluten uns verschlingen. Die Jünger schreien laut auf. Aber eine vertraute Stimme reißt sie heraus aus ihrem Alptraum – eine Stimme, die sogar das Pfeifen und Heulen des Sturmes durchdringt: „Fürchtet euch nicht. Ich bin es.“ Das ist die Stimme von Jesus. Und jetzt sehen die Jünger ihn auch. Es ist kein Gespenst, es ist Jesus. Jesus auf dem Wasser, mitten im Sturm, einfach so? Als ob es keine Naturgesetze gäbe. Als ob das so einfach wäre mit den Stürmen des Lebens: Da kämpfe ich schon eine ganze schlaflose Nacht lang. Ich kämpfe mit Wind und Wellen und Sorgen und Alpträumen. Und dann kommt da Jesus ganz leichtfüßig über das Wasser gelaufen und sagt: „Fürchte dich nicht. Ich bin es.“ Als ob das gleich alle meine Probleme lösen würde. Schließlich stürmt es noch immer in meinem Leben. Wieso sollte ich also keine Angst mehr haben? Da könnte ja jeder kommen und behaupten, jetzt wird alles gut. Wer sagt mir, dass das wirklich Jesus ist und nicht nur ein Gespenst? Irgendein Hirngespinst, das sich meine verworrenen Gedanken selber ausgedacht haben in dieser schlaflosen Nacht? „Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser,“ sagt Petrus. Schließlich muss ich meinen Weg selber gehen. Ich muss selber das durch durch diese Nacht. Ich muss selber erfahren, dass der Boden trägt unter meinen Füßen, egal, wie schwankend er ist. Jesus sagt zu Petrus: „Komm her!“ Und Petrus wagt es. Er steigt aus dem Boot. Er verlässt das letzte bisschen Sicherheit, das ihm geblieben ist im Sturm seines Lebens. Petrus riskiert es, vollends den Boden unter den Füßen zu verlieren. Mit dem Mut der Verzweiflung steigt er aus dem Boot, das wohl ohnehin bald zerschellen wird in den Stürmen dieser Nacht. Aber jetzt hat er ein Ziel vor Augen. Er hat einen Weg, der ihn aus dieser Ausweglosigkeit herausführt. Petrus geht zu Jesus. Er weiß: Nur Jesus kann mir helfen. Auch wenn da überhaupt kein Weg ist, den ich gehen kann – nur Sturm und Wellen und Vernichtung. Jesus weiß einen Weg für mich.
Petrus vertraut Jesus. Aber der Sturm ist immer noch da. Die Wellen stehen vor Petrus wie Berge. Es ist Wahnsinn, was ich hier tue, durchfährt es Petrus wie ein Blitz. Es ist Wahnsinn, einfach loszulassen und zu vertrauen. Einfach loszugehen ohne Weg und nicht danach zu fragen, wie tief es runter geht unter mir. Der Wind pfeift Petrus ins Gesicht. Und nach unten geht es tief runter. Wie konnte er da jemals so etwas wie Boden unter den Füßen verspüren? Petrus versinkt in den Fluten. Er kommt da nicht mehr raus aus dieser schlaflosen Nacht. Die Tiefe verschluckt ihn. Jetzt ist es aus, durchfährt es ihn. Aber da spürt er eine Hand. Eine Hand, die ihn hält. Eine feste und kräftige Hand. Die Hand zieht Petrus aus den Fluten. Jesus ist da – greifbar, spürbar, erfahrbar. „Warum hast du gezweifelt?“ fragt Jesus ihn. Petrus weiß keine Antwort. Er weiß nur: Ich bin gerettet. Die Abgründe, die sich vor mir aufgetan haben, haben sich wieder geschlossen. Und wenn ich es nicht allein schaffe, dann ist Jesus da und nimmt mich bei der Hand. Die Stürme des Lebens legen sich wieder. Die schlaflose Nacht ist vorüber mit ihrer Verzweiflung und ihren Sorgen. Jesus kann helfen. Die Jünger fallen vor Jesus nieder und sagen: „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer