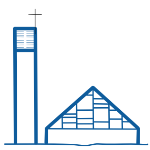Predigt zum 17. Sonntag nach Trinitatis, 9. Oktober 2022
Jesaja 49, 1-6: Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln! Gebt acht, ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand, hat er mich bereitgehalten. Wie einen spitzen Pfeil hat er mich in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir: »Du bist mein Knecht. Du trägst den Namen ›Israel‹. Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin.« Ich aber sagte: »Ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht, mein Gott wird mich belohnen.« Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen, mein Gott gab mir die Kraft dazu. Und jetzt sagt er: »Ja, du bist mein Knecht. Du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig: Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung.«
Liebe Mitchristen!
Beim Heuberg- Erlebnis- Tag vor zwei Wochen hörte man in Wehingen immer wieder das Martinshorn der Feuerwehr. Aber nicht weil, ein Feuerwehr- Einsatz gewesen wäre. Stattdessen saßen da mit leuchtenden Augen Kinder im Feuerwehrauto. Für viele war das das Größte, dort einmal mitfahren zu dürfen mit den Feuerwehrleuten. Kein Wunder, dass viele Kinder sagen: „Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Feuerwehrmann.“ Was werde ich mal, wenn ich groß bin? Für Kinder ist die Antwort auf diese Frage oft ganz einfach. Später, wenn sie als Jugendliche dann wirklich vor dieser Entscheidung stehen, da ist die Antwort oft nicht mehr so leicht. Ich sehe es an meinem 17jährigen Sohn, der im nächsten Jahr mit der Schule fertig sein wird. In welche Richtung möchte ich gehen, was will ich später mal machen? Da gibt es Vieles, was ihn interessieren würde. Aber man kann eben nicht alles machen, sondern nur eines davon. Man muss sich entscheiden. Eine solche Entscheidung zu treffen, ist einfacher, wenn man mit Jemandem darüber reden kann. Und so fragt mich mein Sohn um Rat: „Was soll ich nach der Schule mal machen?“
Was soll ich werden, welchen Beruf soll ich ergreifen? Was würden Sie, liebe Tauffamilien ihren Kindern später einmal raten? Was würden Sie ihnen wünschen? „Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Feuerwehrmann,“ sagen viele Kinder – voller Überzeugung und ohne jeden Zweifel. Und manchmal ist ihr Berufswunsch auch ein anderer. Manchmal ist es z. B. einfach der Beruf der Eltern. Denn die Eltern sind das Vorbild für die Kinder. Gibt es Menschen, bei denen schon von klein auf klar ist, welchen Beruf sie später ergreifen? Ja, Mancher bleibt tatsächlich bei dem Berufswunsch, den er schon von Kindertagen an hatte. „Das passt wirklich zu dir. Du bist wirklich der geborene Feuerwehrmann,“ sagen wir dann zu einem solchen Menschen.
In unserem Predigttext lesen wir von einem Menschen, bei dem von Anfang an klar war, welchen Beruf er ergreifen würde. Gott hat ihn dazu berufen, sein Prophet zu sein, vom ersten Anfang seines Lebens an. Dieser Mann hieß Jesaja- genauso wie ein großer und bekannter Prophet, der einige hundert Jahre vor ihm gelebt hatte, und von dem die Bibel auch berichtet. Aber die Zeiten hatten sich geändert seither. Nichts war mehr so wie damals. Es stand sozusagen kein Stein mehr auf dem anderen. Jerusalem war zerstört, auch der Tempel war kaputt. Die Oberschicht war in ein fremdes, fernes Land verschleppt worden. Dort in Babylon lebten sie nun im Exil.
Wie ist das, wenn man alles hinter sich lassen muss? Wenn die Heimat vom Krieg zerstört ist und man in der Fremde leben muss? Ich denke an die Menschen aus der Ukraine, die in unserem Land Zuflucht suchen. Wie schwer muss das für sie sein. Was bleibt, wenn das vertraute Umfeld, in dem man sich sicher und geborgen gefühlt hat, auf einmal nicht mehr da ist? Bei den Israeliten waren es die Geschichten, die sie sich erzählt hatten. Geschichten von Gott, der ihren Vorfahren geholfen hat. Der ihr Elend angesehen hat und sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat in ein gutes Land. Dort in der Fremde in Babylon haben die Israeliten in ihrer Not Trost und Halt in ihrem Glauben gefunden. Sie haben viel mehr über Gott nachgedacht als je zuvor. Dadurch haben sie neue Antworten auf wichtige Fragen gefunden- Antworten, die auch für uns heute bedeutsam sind: Ja, sie waren aus der Heimat vertrieben worden. Aber das bedeutete nicht, dass Gott sie vergessen hatte oder dass es Gott gar nicht gibt. Gott war da, auch in der Fremde. Und auch diese schwere Zeit des Exils in Babylon gehörte zu Gottes unerforschlichem Willen. Auch das Exil war Gottes Wille. Das war eine gewagte Behauptung. Aber diese gewagte Behauptung hat den Israeliten damals geholfen in ihrer schwierigen Situation. Diese Behauptung hat ihnen die Augen dafür geöffnet, wo sie selber Mitschuld an dieser Katastrophe hatten. So sind die Menschen damals gerade durch ihre schwierige Lage ganz neu zum Glauben an Gott gekommen. Denn sie haben es erlebt: Gott liebt Israel weiterhin.
Gott liebt uns – auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind. Gott liebt uns- auch wenn wir selbst nichts dazu beitragen können, weil wir zu klein oder zu schwach oder einfach hilflos sind. Ja, Gott liebt uns- vom allerersten Anfang unseres Lebens an, als noch kein Mensch von uns wusste: „Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben.“ So sagt es der zweite Jesaja in unserem Predigttext. Einen Beruf hat Gott ihm vom allerersten Anfang seines Lebens an gegeben: Den Beruf des Propheten. Gottes Knecht sollte er sein. Damals war das eine Ehrenbezeichnung. Der Knecht des Königs war ein sehr wichtiger Mann. Er war der Minister des Königs. So sollte Jesaja als Knecht Gottes den Menschen von Gott erzählen. Er sollte sie darauf hinweisen, was Gottes Wille ist. Wie sie ihr Leben führen sollten, damit es ein gutes Leben wird, vor Gott und den Menschen. Und er sollte in seinem Volk die Hoffnung wachhalten – die Hoffnung, dass sie nicht von Gott verlassen sind, trotz aller äußeren Not. Und mehr noch: Das was, der Prophet Jesaja sagt, gilt nicht nur für die Israeliten damals. Nein, es gilt für alle Welt. Es gilt auch für uns heute: „Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung.“ So sagt es Gott.
Gott hat dem zweiten Jesaja einen Beruf gegeben, eine Berufung. Beruf und Berufung, diese beiden Wörter gehören zusammen. Wozu sind wir berufen? Wir sind alle keine Propheten, zu denen Gott so unmittelbar und eindringlich spricht wie zu diesem Jesaja. Wir sind auch nicht so wortgewaltig wie dieser Mann. Anders als er haben wir nicht immer die scharf geschliffenen Worte, die den Nagel genau auf den Kopf treffen und die Herzen der Menschen bewegen können. Unsere Worte sind nicht immer wie der Pfeil, der ins Schwarze trifft. Manchmal gehen sie auch am Ziel vorbei oder laufen ins Leere. Und manchmal sind wir auch einfach nur müde und denken: Es bringt doch alles nichts, was ich mache. Diese Erfahrung hat Jesaja allerdings auch machen müssen – dass er den Eindruck hat: „Ich habe mich vergeblich bemüht.“ Aber: So wie Jesaja haben wir eine Berufung von Gott, einen Beruf. Etwas, wozu Gott uns die Begabung und die Fähigkeit geschenkt hat. Etwas, womit wir uns nützlich machen und unsere Welt ein klein wenig besser machen können. Wenn wir diese unsere Berufung leben, dann ist das ein Dienst an Gott und an den Menschen. Es ist also im ganz wörtlichen Sinn ein Gottesdienst. So hat das auch Martin Luther gesehen. Wenn die Magd im Stall die Kuh melkt, wenn die Mutter zuhause dem Kind die Windeln wechselt, dann ist das alles genauso ein Gottesdienst, wie wenn der Priester in der Kirche eine Messe feiert. So sagt Martin Luther.
Was ist unser Beruf, unsere Berufung? Und was werden unsere Kinder später einmal werden? Ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau? Vielleicht wird es auch etwas ganz Anderes sein. Aber ich wünsche es unseren Kindern und ich wünsche es uns allen: Dass wir ein offenes Ohr haben für Gottes Stimme in unserem Leben. Dass wir die Berufungen und Begabungen, die Gott uns schenkt, leben können zum Wohl der Menschen und zur Ehre Gottes. Und dass wir, wenn wir mal frustriert sind oder durch schwere Zeiten gehen müssen, uns immer festhalten können an Gottes Versprechen: „Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung.“
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer