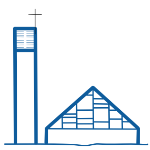Predigt zum 16. Sonntag nach Trinitatis, 19. September 2021
Klagelieder 3,22-26 und 31-32: Die Güte des Herrn ist’s, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig; sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen.
Liebe Mitchristen!
Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht: Was für ein wunderschöner Morgen. Die Sonne scheint, beinahe wie im Sommer. Und das, obwohl es schon September ist. Richtig spätsommerlich schön ist es jetzt. Fast wie eine kleine Entschädigung für den kalten und verregneten Sommer, den wir hatten. Und ich denke zurück an den Sommer, der jetzt hinter uns liegt. Ich denke an die Ferien und an den Urlaub. Ich denke an die wenigen Sonnentage, die wir in diesem Sommer doch auch hatten. Wo konnte ich diese schönen Tage genießen? Vielleicht war das irgendwo in der Ferne, an einem schönen Urlaubsort. Aber mit dem Verreisen war es ja immer noch schwierig, und so manche Planung musste ich wegen Corona wieder über den Haufen werfen. Also bleibe ich in meinen Gedanken hier auf dem Heuberg, wenn ich an den vergangenen Sommer zurückdenke. Ich denke an einen der wenigen richtig sommerlichen Tage hier, und ich bin draußen in der Natur. Pflanzen und Tiere gibt es hier zu sehen: Blumen, Schmetterlinge und Vögel. Ein Vogel ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Die Lerche. Ein kleiner und unauffälliger brauner Vogel ist das. So ist die Lerche gut getarnt und draußen in der Wacholderheide kaum zu erkennen. Ich erkenne die Lerche nur an ihrem Gesang – und vor allem erkenne ich die Lerche daran, wie sie singt. Die Lerche ist nicht wie die anderen Vögel, die irgendwo auf einem Baum sitzen und singen. Die Lerche sitzt ganz unten im Gras. Von dort unten vom Boden startet sie dann und fliegt los. Fast senkrecht steigt sie nach oben in den Himmel. Und dort ganz oben am Himmel sehe ich sie nur noch als einen winzigen Punkt. Da bleibt sie in der Luft stehen und zwitschert aus voller Kehle. Sie singt so laut, dass man sie über die ganze Wacholderheide hört.
Es ist schon etwas Besonderes, dass wir hier auf dem Heuberg immer wieder auch den Gesang der Lerche hören können. In Deutschland gehört sie inzwischen zu den bedrohten Arten, und in manchen Gegenden ist ihr Gesang schon ganz verstummt. Für unsere Großeltern war der fröhliche Gesang der Lerche noch ein täglicher Begleiter. Ihr lateinischer Name „Alauda“ wurde als „Lauda Deum“, Gott loben, gedeutet. Und ihr Zwitschern verstand der Volksmund als Beten. „Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.“ So heißt es in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Das klingt feierlich. Gottes Barmherzigkeit, das ist ein altes und feierliches Wort. Gott liebt uns. Gott ist immer für uns da, an jedem Tag, an jedem neuen Morgen. Das ist damit gemeint. Was ist da wirklich dran an Gottes Liebe und an Gottes Barmherzigkeit, von der wir hier in der Kirche immer reden? Hat das etwas mit mir zu tun? Kann ich das wirklich erleben und spüren in meinem Leben? Ja, Gottes Liebe und Barmherzigkeit kann ich erleben und spüren in meinem Leben – zum Beispiel an einem sonnigen Morgen wie heute, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Dann spüre ich etwas von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Und dann mache ich es wie die Lerche, und ich fange an zu singen. Und auch wenn ich keine Flügel habe, die mich ganz nach oben in den Himmel tragen, mit meinem Herz bin ich dann doch dort oben – ganz nahe bei Gott.
So haben zu allen Zeiten die Menschen ihre Lieder gesungen für Gott. Die Melodien und die Rhythmen haben sich immer wieder verändert in all den Zeiten. Und das darf auch so sein. Nicht jeder mag dieselbe Musikrichtung. Nicht der Musikstil ist wichtig, sondern dass wir mit dem Herzen dabei sind. Schon in der Zeit der Bibel haben die Menschen solche Lieder gesungen für Gott. Die Melodien dieser Lieder kennen wir heute nicht mehr. Aber die Texte sind in der Bibel aufgeschrieben: „Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.“ Das ist so ein Liedtext aus der Bibel. Dieser Liedtext gehört in eine ganze Liedersammlung, die in der Bibel steht. Diese Liedersammlung hat die Überschrift: Klagelieder Jeremias.
Klagelieder. Davon könnten wir auch ein Lied singen. Von dem, was alles nicht so gut läuft. Angefangen von dem verregneten Sommer, von diesen Sommerferien, die wir uns anders vorgestellt hatte. Und jetzt im neuen Schuljahr zieht das Tempo wieder voll an. Und die Schülerinnen und Schüler fragen sich: Wie soll ich das bloß schaffen, die Lücken aufzuholen vom letzten Schuljahr, wo es wegen Corona kaum normalen Unterricht gab? Viel gibt es, was nicht so gut läuft. Freundschaften, die zerbrechen. Streit in der Familie, Mobbing und Zukunftsängste gibt es.
Der Prophet Jeremia hatte auch viel Grund zur Klage. Sein Volk Israel ist von Feinden überfallen worden. Diese Feinde hatten die Israeliten gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen. Jetzt lebten sie irgendwo in einem fremden Land, in der fremden Stadt Babylon und in Israel war alles vom Krieg zerstört. „Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.“ Dieses Lied dichtet der Prophet in dieser verzweifelten Lage. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Anlass dafür, so ein fröhliches Lied zu dichten. Gottes Liebe und Barmherzigkeit sind nirgends zu erkennen in dieser dunklen Zeit, in der Jeremia damals lebt. Aber der Prophet dichtet ein Loblied. Und er fängt an zu singen. Und ich stelle mir vor: Während er singt, da spürt er etwas von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Sein Herz hebt sich zum Himmel. Wie kann das sein? Es hat sich doch nichts geändert. Seine Lage und die seines Volkes ist immer noch genauso verzweifelt wie vorher.
Ich denke noch einmal an die Lerche, an diesen kleinen, unscheinbaren Vogel. Etwas Ungewöhnliches geschieht, wenn eine Lerche von einem Raubvogel angegriffen wird. Aufgrund ihrer fehlenden Flugkünste kann sie nur schwer den Angriffen ausweichen. Es geht um ihr Leben. Aber: Wenn sie angegriffen wird, hört sie nicht auf zu singen. Sie zwitschert und trillert aus Leibeskräften mitten in aller Bedrohung. Auch wenn ihr Leben auf dem Spiel steht. Mit ihrem Gesang zeigt sie ihrem Verfolger, welche Kraft sie hat: „Hör mal, Falke, ich singe. Ich habe noch so viel Kraft und Reserven, dass ich mir das leisten kann. Du wirst mich also niemals bekommen können.“ Die Lerche singt weiter. So wie der Prophet Jeremia, der sich nicht unterkriegen lässt in seiner schwierigen Situation. Er hält daran fest: Gott liebt mich. Gott ist immer für mich da, an jedem Tag, an jedem neuen Morgen. Davon singt Jeremia mit seinem Lied: „Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.“ Und dieses Lied gibt ihm Kraft und hilft ihm, sein Leben zu meistern, auch an den dunklen Tagen. Das wünsche ich uns allen.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer