Einspielen „By the rivers of Babylon..“
Liebe Gemeinde,
Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an diesen Song, der in den 1980er Jahren wochenlang auf Platz 1 in den Charts war. Der Text dieses Songs ist der Anfang von Psalm 137.
„An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Doch die Feinde, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder.
Wie könnten wir Lieder zur Ehre Gottes singen im fremden Land?“
Es ist der Klagepsalm der Israeliten, die 597 v. C. von der feindlichen Großmacht der Babylonier aus Jerusalem verschleppt wurden. Sie wurden zwangsumgesiedelt und zum Leben in der Fremde gezwungen. Und nun sitzen sie da – am Euphrat und am Tigris -… und weinen. Voller Sehnsucht nach der Heimat, dem Gelobten Land, der goldenen Stadt Jerusalem mit dem Berg Zion. Sie trauern der guten alten Zeit nach. Sie vermissen ihre Heimat, ihr Heiligtum, ihren Tempel. Ja, wenn sie wieder in der Heimat wären, dann könnten sie Lieder singen und beten. Und lachen und leben. Aber doch nicht hier, in Babylon, in der Fremde, im Feindesland!
Und dann kommt ein Brief aus der Heimat, aus Jerusalem. Jeremia hat ihn geschrieben. Ich lese unseren heutigen Predigttext aus Jer. 29, 1-14
Liebe Gemeinde,
wie gut, wenn es in einer schwierigen Situation ein Zeichen der Anteilnahme gibt, wenn deutlich wird, dass jemand an einen denkt.
Gott denkt an die Israeliten, das macht der Brief Jeremias deutlich. Auch wenn sie sich immer wieder von ihm abgewandt haben, so ist es ihm nicht egal, wie es ihnen geht.
Die Israeliten haben sich sicher über Post aus Jerusalem gefreut. Aber was sie dann lesen mussten dürfte sie überrascht haben. Sie hatten so sehr gehofft, bald wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Und was lesen sie da: „Baut Häuser, pflanzt Gärten, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter,… mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet….“ Kurz gesagt: Richtet euch auf einen längeren Aufenthalt ein.
Akzeptiert eure gegenwärtige Situation und macht das Beste daraus. Trauert nicht den alten Zeiten nach, sondern gestaltet die Gegenwart.Setzt euch da, wo ihr jetzt wohnt, dafür ein, dass man dort gut leben kann. Integriert euch zum Wohle der Stadt. Und v.a. betet für sie, betet für sie zu eurem Gott, damit es ihr und somit auch euch gut geht.
Für die Israeliten, die meinten, Gott sei nur in Jerusalem zu finden und nur dort könne man zu ihm beten, ist das ein revolutionär neuer Gedanke. Gott ist doch da, auch in der Fremde, sogar in Babylon, in dieser vermeintlich so gottlosen Stadt.
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Was könnte das für uns in Zeiten von Corona bedeuten?
Wir leben zwar nicht im Exil, aber doch in einer Art Gefangenschaft. Viele unter uns trauern auch um ihr altes Leben – ich tue es jedenfalls.
Ich halte die Regelungen zur Eindämmung der Pandemie für richtig und dennoch:
Mir fällt es sehr schwer, dass wir unsere Kinder und Enkel gerade nicht so häufig treffen können.
Mir fehlt das Singen in unserem Chor.
Ich fände es schön, wenn ich nicht dauernd überlegen müsste, ob ich jemanden treffen kann und v.a. würde ich sehr gerne wieder Gottesdienste ohne Mundschutz feiern, Gottesdienste, in denen ich keinen Abstand halten muss und in denen ich wieder fröhlich singen kann.
Welchen Brief würde Gott uns heute schreiben? Oder gilt dieser Brief des Jeremia auch uns heute?
Sicher gilt auch für uns: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie!
Aber vielleicht auch:
Geht kreativ mit dieser Situation um.
Seid dankbar, dass ihr gesund seid.
Seid dankbar für die modernen Telekommunikationsmöglichkeiten, mit denen ihr Kontakt halten könnt.
Seid dankbar für Freunde, Nachbarn, Familienangehörige, die sich um euch kümmern.
Seid dankbar für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen.
Vielleicht aber auch:
Überlegt mal, was gerade falsch läuft, in der Gesellschaft, in den Schulen, in der Wirtschaft aber auch in unseren Kirchengemeinden.
Die Kirchen mussten ja im Frühjahr viel Kritik einstecken: sie seien während der Pandemie abgetaucht, hätten alte Menschen in den Seniorenheimen und Sterbende allein gelassen.
Mich hat ein Artikel in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ vom 26. März sehr beeindruckt. Dort wurden die Namen der katholischen Priester abgedruckt, die in Norditalien gestorben sind, weil sie sich um Menschen gekümmert haben, die mit Covid 19 infiziert waren – bis zu diesem Tag mehr als 50.
Julian Urban, 38, Arzt aus der Lombardei schreibt folgendes:
„Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein freundlicher Mann, hatte ernsthafte Atemprobleme, brachte aber eine Bibel mit. Es beeindruckte uns, dass er sie den anderen vorlas und den Sterbenden die Hand hielt.
Wir waren alle zu müde, entmutigt, psychisch und physisch fertig, um ihm zuzuhören. Jetzt aber müssen wir es zugeben: Wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft, wir haben zwei Kollegen, die gestorben sind, andere von uns wurden infiziert. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar freie Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind. Dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken, damit wir uns um die Kranken kümmern können.
Gestern ist der 75-jährige Priester gestorben. Obwohl es in unserem Krankenhaus innerhalb von drei Wochen über 120 Todesfälle gab und wir alle erschöpft und verstört sind, hat es dieser Priester trotzdem geschafft, uns einen FRIEDEN zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften.“
Suchet der Stadt Bestes … Dieser Priester hat dies sicherlich getan.
… und betet für sie:
Allein den Betern kann es noch gelingen
Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten,
so schrieb der Dichter Reinhold Schneider 1936 angesichts der immer brutaler auftretenden Nationalsozialisten.
Die Christen in der ehemaligen DDR haben dies beherzigt. Die Montagsgebete führten schließlich zum unblutigen Umsturz des damaligen DDR Regimes.
In Tuttlingen haben wir von unseren Pfarrern Ende März ein Corona – Abendgebet bekommen, in dem wir gezielt für alle, die unter dieser Situation leiden, beten können.
Vielleicht erinnern Sie sich auch an die Aktion „Deutschland betet gemeinsam“, an der sich Ende März ganz viele christliche Kirchen beteiligten, weil allen klar war, dass wir dringend auf Gottes Hilfe angewiesen sind.
Angesichts der steigenden Infektionszahlen überall auf der Welt, angesichts der Unsicherheiten in Bezug auf Medikamente und einen Impfstoff, gilt für mich weiterhin:
Lasst uns für die Politiker und Politikerinnen beten, dass sie weise Entscheidungen zum Wohle des Landes treffen,
Lasst uns für das Krankenhauspersonal beten,
Lasst uns für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beten, die an Impfstoffen und Medikamenten forschen.
Lasst uns für die Menschen beten, die an Covid 19 erkrankt sind und um ihr Leben ringen.
Wir sind nach wie vor dringend auf Gottes Hilfe angewiesen.
Im Frühjahr ging eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft durch unser Land. Das war sicher eine positive Begleiterscheinung dieser Pandemie. Ich würde mir solch eine Solidarität und Hilfsbereitschaft auch weiterhin wünschen. Sie wäre sicher im Sinne von „Suchet der Stadt Bestes“!
Was sagt Jeremias Brief uns sonst noch?
Ganz sicher gilt auch für uns:
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, … Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung,“
Für ‚Frieden steht‘ im Urtext das Wort ‚Shalom‘. Gott kündigt Shalom an: Unversehrtheit und
Heil. Nicht nur Befreiung von jedem Unheil und Unglück sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit,
Frieden und Ruhe,
Selbst unter solch widrigen Umständen wie dem Exil leuchtet Gottes Liebe auf.
Ich denke, die Israeliten damals waren über die Aussicht, weitere 70 Jahre im Exil leben zu müssen, nicht begeistert. Die wenigsten hatten die Aussicht, die so heiß ersehnte Heimkehr nach Jerusalem noch zu erleben.
Was bedeutet dann diese Zusage Gottes für die Exilanten damals?
Was bedeutet sie für uns heute?
Sie kennen sicher den Spruch „Es ist besser ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen“.
Diese Zusage Gottes war solch ein Licht inmitten der Dunkelheit des Exils, sie gab Hoffnung und ermutigte zum Durchhalten. „Auch in der Fremde bin ich bei euch und möchte, dass es euch gut geht. Und ich verspreche euch, dass eure Leidenszeit ein Ende haben wird.“
Diese Zusage Gottes ist für mich auch solch ein Licht inmitten der Dunkelheiten unserer Zeit.
In der Welt gibt es Naturkatastrophen und von Menschen gemachte Katastrophen, aber Gott begleitet uns in solchen Katastrophen. Ich denke, wir können gerade in schwierigen Zeiten immer wieder Spuren der Liebe und Begleitung Gottes entdecken.
Und er gibt uns die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird, dass auch diese Leidenszeit zu Ende gehen wird.
Als Christinnen und Christen glauben wir an den auferstandenen Jesus Christus, der den Tod besiegt hat.
Als Christinnen und Christen glauben wir an den auferstandenen Jesus Christus, der versprochen hat jeden Tag bei uns zu sein bis ans Ende der Zeit.
Und als Christinnen und Christen glauben wir an eine Zukunft in der neuen Welt Gottes, in der endlich alle Tränen abgewischt sind und Not, Leid, Geschrei und der Tod ein Ende haben werden, an eine Zukunft, in der der Zustand des ‚Shalom‘ verwirklicht sein wird.
In einem Liedvers heißt es:
Du, Herr, heißt uns hoffen und gelassen vorwärts schau‘n.
Deine Zukunft steht uns offen, wenn wir dir fest vertrau‘n.
Amen!
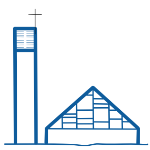


 „Komm schon, trau’ dich!“ Der Junge steht auf dem Drei-Meter-Brett im Schwimmbad. Er ist der letzte, der noch springen muss. Alle anderen haben es bereits hinter sich, feuern ihn vom Beckenrand an. Drei Meter hoch ist das Sprungbrett, das Wasser darunter noch einmal mindestens ebenso tief und kristallklar. Man sieht den Grund, hat das Gefühl, es geht viel tiefer herunter. Der Junge hat Angst, würde am liebsten umkehren, will sich aber nicht blamieren. Die anderen sind schließlich auch alle gesprungen; er wäre der einzige. „Komm schon, trau’ dich!“ ruft ihm sein Freund vom Beckenrand zu. Der Sprung vom Drei-Meter-Brett gilt als „Mutprobe“. Er ist nicht gefährlich, wenn man ordentlich schwimmen kann, aber es erfordert beim ersten Mal Überwindung, sich ins Wasser fallen zu lassen. Die meisten tun das auch. Sie springen einfach. Und wer sich nicht traut, der klettert eben wieder herunter. Anfangs ist das vielleicht peinlich, später lacht man darüber.
„Komm schon, trau’ dich!“ Der Junge steht auf dem Drei-Meter-Brett im Schwimmbad. Er ist der letzte, der noch springen muss. Alle anderen haben es bereits hinter sich, feuern ihn vom Beckenrand an. Drei Meter hoch ist das Sprungbrett, das Wasser darunter noch einmal mindestens ebenso tief und kristallklar. Man sieht den Grund, hat das Gefühl, es geht viel tiefer herunter. Der Junge hat Angst, würde am liebsten umkehren, will sich aber nicht blamieren. Die anderen sind schließlich auch alle gesprungen; er wäre der einzige. „Komm schon, trau’ dich!“ ruft ihm sein Freund vom Beckenrand zu. Der Sprung vom Drei-Meter-Brett gilt als „Mutprobe“. Er ist nicht gefährlich, wenn man ordentlich schwimmen kann, aber es erfordert beim ersten Mal Überwindung, sich ins Wasser fallen zu lassen. Die meisten tun das auch. Sie springen einfach. Und wer sich nicht traut, der klettert eben wieder herunter. Anfangs ist das vielleicht peinlich, später lacht man darüber. Stellt euch vor: Ihr habt euch verlaufen in einem sehr großen Wald. Weit und breit ist kein Weg zu sehen, nicht einmal ein Trampelpfad. Die Sonne geht unter, die Abenddämmerung kommt. Der Himmel ist bewölkt. Das Handy hat keinen Empfang. Um euch herum sind nur Bäume. Und jetzt? Wie kommt ihr jetzt wieder aus dem Wald heraus? Einer aus eurer Gruppe sagt: Wir steigen auf den nächsten Berg. Da oben haben wir den Überblick. Aber bis nach ganz oben ist es weit. Bis dahin wird es Nacht sein, dann sieht man gar nichts mehr. Also keine gute Idee. Dann vielleicht auf einen Baum klettern? Aber so wie die Bäume hier im Wald dastehen, funktioniert das auch nicht. Die haben unten gar keine Äste. Dann müssen wir uns eben einen Platz zum Übernachten suchen. Ein Zelt bauen aus Ästen, und die Regenjacke darüberbreiten. Wenn es wieder hell wird, sehen wir weiter. Aber wollt ihr wirklich im Wald übernachten? Es könnte kalt werden heute Nacht. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit?
Stellt euch vor: Ihr habt euch verlaufen in einem sehr großen Wald. Weit und breit ist kein Weg zu sehen, nicht einmal ein Trampelpfad. Die Sonne geht unter, die Abenddämmerung kommt. Der Himmel ist bewölkt. Das Handy hat keinen Empfang. Um euch herum sind nur Bäume. Und jetzt? Wie kommt ihr jetzt wieder aus dem Wald heraus? Einer aus eurer Gruppe sagt: Wir steigen auf den nächsten Berg. Da oben haben wir den Überblick. Aber bis nach ganz oben ist es weit. Bis dahin wird es Nacht sein, dann sieht man gar nichts mehr. Also keine gute Idee. Dann vielleicht auf einen Baum klettern? Aber so wie die Bäume hier im Wald dastehen, funktioniert das auch nicht. Die haben unten gar keine Äste. Dann müssen wir uns eben einen Platz zum Übernachten suchen. Ein Zelt bauen aus Ästen, und die Regenjacke darüberbreiten. Wenn es wieder hell wird, sehen wir weiter. Aber wollt ihr wirklich im Wald übernachten? Es könnte kalt werden heute Nacht. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit?