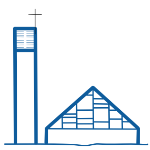Predigt zum 4. Sonntag nach Trinitatis, 27. Juni 2021
1. Mose 50, 15-21: Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters! Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
Liebe Mitchristen!
Mögen Sie Regenbögen? Ich habe letzte Woche einen wunderschönen Regenbogen gesehen. Ich war mit dem Auto unterwegs, auf der Rückfahrt von Tuttlingen. Es war schon Abend. Das Wetter war unbeständig, mal Sonne, mal Wolken. Auf einmal war da dieser großartige, doppelte Regenbogen über dem Donautal – von einem Ende des Horizonts bis zum anderen. Der Anblick hat mich fasziniert. Ich fahre mein Auto in eine Parkbucht und steige aus, um diesen Augenblick auf mich wirken zu lassen. Es ist wunderschön hier.
Regenbogenfarben, so stelle ich mir das Kleid vor, das Josef als Siebzehnjähriger von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Josefs Brüder konnten diesen Anblick nicht ertragen. Josef wird ihnen unerträglich, sie wollen ihn loswerden. Auch sein Tod wäre ihnen recht. Schließlich werfen sie ihn in ein tiefes Brunnenloch und verkaufen ihn in die Sklaverei. Ein Sklave in einem bunten Kleid. In Ägypten macht er Karriere. Durch sein kluges Management verhindert er eine Hungersnot und kann sogar noch Getreide verkaufen an die Hungernden aus den Nachbarländern. Auch Josefs Brüder kommen zu ihm nach Ägypten zum Getreidekauf. Die Brüder versöhnen sich. Sie ziehen alle nach Ägypten, wo es genug Weide gibt für ihr Vieh und sie nicht mehr hungern müssen. Auch ihr alter Vater Jakob kommt mit.
Jakob, der seinem Sohn Josef damals dieses besondere Kleid geschenkt hatte. Ein buntes Kleid, so steht es in unseren Bibelübersetzungen. An anderer Stelle in der Bibel, in 2. Samuel 13,18, ist genauer erklärt, was dieses hebräische Wort bezeichnet: Solche Kleider trugen die Töchter des Königs, solange sie Jungfrauen waren. Josef trägt auch so ein Kleid. Ein Kleid, wie es die Prinzessinnen anhaben, nicht die Prinzen. Das ist Josefs Lieblingskleidungsstück. Josef passt nicht in das übliche Schema, wie man sich einen Mann oder eine Frau vorstellt. Zu allen Zeiten gab es solche Menschen. Heute verwenden diese Menschen den Regenbogen als Symbol. Ich denke wieder an den wunderschönen Regenbogen über dem Donautal, den ich gesehen habe. Man kann in diesen Farben auch Fußballstadien illuminieren, jetzt bei der Europameisterschaft. Bei der Allianz-Arena in München hat die UEFA das verboten. Wie gehen wir heute um mit Menschen, die nicht in das übliche Schema passen, wie wir uns einen Mann oder eine Frau vorstellen? Ein schwieriges Thema, gerade auch für uns in der Kirche. Sicherlich sind wir da nicht alle einer Meinung. Und sicherlich sind da auch Ängste da.
Auch Josefs Brüder hatten Ängste. Ihr Vater Jakob hatte die Familie zusammengehalten. Aber nun war er gestorben. Wie würde es nun weitergehen? Würde Joseph sich rächen für das, was sie ihm damals angetan hatten wegen seinem bunten Kleid? Schließlich saß Joseph jetzt am längeren Hebel, als Vertrauter des Pharaos.
Die Angst der Brüder ist so groß, dass Joseph gar nicht unter die Augen treten können. Sie schicken jemand anderes und lassen Joseph ausrichten, was sie ihm sagen wollen: „Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Joseph sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben.“ So groß ist die Angst. Sie können Josef nicht einmal von sich aus bitten: Verzeih uns doch! Sie schaffen das nur, indem sie sich auf ihren verstorbenen Vater berufen: Er hat doch gesagt, du sollst uns verzeihen. Ob Jakob diese Worte wohl wirklich gesagt hat vor seinem Tod? Oder haben die Brüder sich diese Worte ausgedacht – sozusagen als Notlüge, um die Versöhnung mit Joseph zu erreichen? Das bleibt in unserem Predigttext offen.
Ist es nur die Angst, die die Brüder zu diesem Versöhnungsversuch treibt? Oder haben sie sich geändert seither? Missetat und Sünde nennen sie das, was sie Josef angetan haben. Sie wollten Josef vernichten, weil er so anders war. Zu dieser Tat stehen sie jetzt. Sie wollen sich da nicht rausreden. Was sie Josef angetan haben, soll beim Namen genannt werden: Es war eine Missetat und Sünde, eine Ungerechtigkeit, ein Verbrechen. Sie sehen ihre eigenen Grenzen – dass sie Josef nicht so annehmen konnten, wie er war, dass sie schuldig geworden sind an Josef. Die eigenen Fehler sehen und ansprechen zu können – das öffnet ein Tor zur Versöhnung. So kann sich Joseph ihre Bitte um Versöhnung zu Herzen nehmen. Diese Bitte geht ihm so nahe, dass er weinen muss. Josephs Tränen überwinden den tiefen Graben zwischen ihm und seinen Brüdern. Die Brüder trauen sich jetzt, direkt zu ihm hinzugehen. Die Distanz ist überwunden. Eine direkte Begegnung ist möglich.
Joseph gelingt es, dass die Begegnung zwischen ihm und seinen Brüdern zu einer Begegnung auf Augenhöhe wird. Er nutzt die Situation nicht aus, um Herrschaft über seine Brüder auszuüben. „Stehe ich denn an Gottes Statt?“ fragt er und bekennt damit: Gott allein gebührt die Herrschaft. Gott kennt uns Menschen, jeden in seiner Besonderheit. Er kennt unsere unsere dunklen Punkte und blinden Flecke. Gott kennt und liebt auch die Menschen, die anders sind als wir, die nicht in das übliche Schema von Mann und Frau passen. Und Gott weiß um die Unsicherheit, um die Ängste, die viele von uns spüren, wenn wir solche Menschen im Blick haben.
Ich denke wieder an den Regenbogen. In der Bibel ist er ein Zeichen für die Versöhnung. Gott will sich nicht rächen an den Menschen für ihre bösen Taten. Er will die Erde nicht vernichten. Nach dem großen Regen, nach der zerstörerischen Sintflut stellt Gott seinen Bogen in die Wolken und schließt mit Noah den Bund der Versöhnung. Gott will, dass wir leben. So kann auch Josef in seinem schweren Schicksal Gottes Plan erkennen, wenn er seinen Brüdern sagt: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk.“ Dadurch, dass Joseph als Sklave nach Ägypten kam, konnte er dort Getreidespeicher bauen lassen, die die Menschen vor dem sicheren Hungertod bewahrt haben.
Gott kann alles zum Guten wenden. So wie Josephs Brüder die Last ihrer Schuld loswerden, so will er auch uns heute von unserer Schuld befreien. Jesus Christus hat sie auf sich genommen, und ist am Kreuz für uns gestorben. So schließt Gott seinen neuen Bund mit uns. Jesus befreit mich von der Last meiner Schuld. Er schenkt mir einen neuen, unverstellten Blick für die Menschen um mich herum, in all ihrer Unterschiedlichkeit. Da muss ich niemanden in ein Schema pressen, in das er oder sie nicht passt. Da muss ich keine Angst haben vor dem, was mir fremd erscheint. Bunt und vielfältig wie den Regenbogen hat Gott die Welt gemacht. Der Bund seiner Versöhnung gilt – für uns alle, so unterschiedlich wir sind. Daran will ich denken, wenn ich das nächste Mal so einen wunderschönen Regenbogen am Himmel stehen sehe.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer