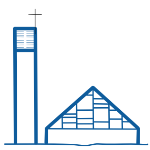1. Kön 17, 2-16: Danach kam das Wort des Herrn zu Elija: »Geh weg von hier in Richtung Osten! Versteck dich am Bach Kerit, der in den Jordan fließt! Aus dem Bach kannst du trinken. Den Raben habe ich befohlen, dich dort zu versorgen.« Da ging er los und tat, was der Herr befohlen hatte. Morgens und abends brachten Raben ihm Brot und Fleisch. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elija: »Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt! Denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen.« Da machte sich Elija nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elija sprach sie an und sagte: »Hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser.« Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: »Bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit.« Da antwortete sie: »So gewiss der Herr, dein Gott, lebt! Ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben.« Da sprach Elija: »Fürchte dich nicht! Geh nur und tu, was du gesagt hast. Aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinem Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehlkrug wird nicht leer werden, und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird.« Sie ging los und tat, was Elija gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen: Elija, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht.
Liebe Mitchristen!
Es ist schön, dass wir im Gottesdienst wieder miteinander singen können. Es tut einfach gut. Mit unseren Liedern loben wir Gott und danken ihm für alles Gute, das Gott uns schenkt. So wie es Paul Gerhard in dem Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“ auf den Punkt bringt: Gott schützt uns, Gott wärmt uns. Gott sorgt dafür, dass wir zu Essen haben und in Frieden leben können. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen – Gott sei Dank! Und wie wenig selbstverständlich ist das alles.
Ich denke an die Menschen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Es erschreckt mich, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben. Und wie viele Menschen nur ihr nacktes Leben retten konnten, und jetzt buchstäblich vor dem Nichts stehen. Der Klimawandel und seine dramatischen Folgen stehen mir da auf einen Schlag ganz drastisch vor Augen – und auch die Aufgabe, die wir haben: Gott hat uns diese Erde anvertraut. Dass sie bewohnbar bleibt, auch für unsere Kinder und Enkel, dafür braucht es unseren vollen Einsatz.
Unsere Erde ist zerbrechlich und braucht unseren Schutz. Auch unser Leben ist zerbrechlich. Manchmal geht es einfach nicht mehr weiter ohne Hilfe von außen. So wie die Menschen in den Hochwassergebieten es jetzt erleben müssen. Ein Mann sitzt auf seinem Autodach, sein Auto ist fast schon in den ungeheuren Wasserfluten verschwunden. Da kommt das Boot der Feuerwehr und rettet ihn – gerade noch rechtzeitig. Ohne Hilfe von außen hätte dieser Mann sein Leben verloren.
Auch der Prophet Elia hat das am eigenen Leib erlebt: Ohne Hilfe von außen geht es einfach nicht mehr weiter, habe ich keine Überlebenschance. Die Katastrophe, die dieser biblische Prophet erleben musste, war eine große Dürre. Alles ist vertrocknet auf den Feldern, und es gab nichts mehr zu essen. Elia bekommt Hilfe von in dieser lebensbedrohlichen Situation. Gott schickt ihm Hilfe. Elia erlebt: Auch diese Hilfe, die Gott schickt, ist zerbrechlich. Gott schickt ihm Raben, die ihn mit Essen versorgen. Raben sind eigentlich keine besonders zuverlässigen Essenslieferanten, und auch keine besonders appetitlichen: Schmutzige, schwarze Vögel, die auch Aas fressen. Aber die Versorgung funktioniert – zumindest eine Zeitlang. Denn die große Dürrekatastrophe lässt sich nicht aufhalten. Der Wassermangel wird immer größer. Auch der Bach, aus dem Elia trinkt, vertrocknet nach einer Zeit.
Gott muss sich etwas Anderes ausdenken, damit Elia nicht verhungert und verdurstet. Gott schickt seinen Propheten weiter. 5 Tagereisen weit entfernt ist seine nächste Station, in einem fremden Land. Und ausgerechnet zu einer Witwe soll Elia da gehen. Eine Witwe – die hatte doch selber nichts. Es gab ja keine soziale Absicherung damals. Und noch dazu hatte diese Witwe noch einen Sohn zu versorgen. Die Hilfe, die Gott schickt, ist zerbrechlich. Es hätte auch schiefgehen können. Die Witwe hätte auch Nein sagen können. Und der weite Weg vom vertrockneten Bach bis nach Sarepta war eigentlich kaum zu schaffen.
Elia hat den Weg geschafft, und die Witwe hat nicht Nein gesagt. Die Witwe war mutig. Sie hat diesem ausländischen Propheten ihren letzten Bissen Brot gegeben. Dabei redet dieser fremde Mann, als ob er vor Hunger schon verrückt geworden wäre. Er sagt der Witwe: Wenn du mir aus deinen letzten Vorräten ein Brot bäckst, dann wird danach immer noch genug zu Essen da sein für deinen Sohn und dich. Das klingt wenig überzeugend, wenn das ein dahergelaufenener Fremder zu einem sagt. War es der Mut der Verzweiflung, dass die Witwe dem Propheten zu Essen gegeben hat? Vielleicht hat er ja Recht, könnte sie gedacht haben. Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Was habe ich schon zu verlieren. Ob mein Sohn und ich schon heute nichts mehr zu Essen haben oder erst morgen – was ändert das noch an unserem Schicksal? Jedenfalls hat die Witwe es gewagt. Sie hat Elia vertraut und hat ihn versorgt. Sie hat es erleben dürfen: Das Essen reicht für uns alle. Wir müssen nicht verhungern. Ein Wunder, etwas Unerklärliches ist geschehen. Ein Grund zur Freude und zum Dank. Vielleicht hat sie auch ein fröhliches Lied angestimmt, so wie das Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“?
Paul Gerhard hat dieses fröhliche Lied gedichtet. Ein Danklied an Gott, der uns gibt, was wir zum Leben brauchen. Man könnte meinen, das Lied stammt aus guten und sicheren Zeiten, wo die Menschen und auch dieser Liederdichter gut versorgt waren und das alles immer so erleben konnten, wie es in dem Lied besungen wird: Dass Gott den Menschen Schutz und Wärme gibt. Dass Gott für die Menschen sorgt, so dass sie genug zu Essen haben und in Frieden leben können. Aber so einfach und unbeschwert war das Leben nicht – damals in der Zeit, in der Paul Gerhardt lebte.
Paul Gerhardt musste selbst so viel Elend erleben, schon allein bis zum Jahr 1653, als er das Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“ schrieb. Die Eltern hat er früh verloren, die Pest und den Krieg hat er gesehen – grausam und unerbittlich. Er hatte erleben müssen, wie täglich tausende Menschen an Hunger sterben. Die grausamen Bilder des Dreißigjährigen Krieges und des schwarzen Todes standen ihm immer vor Augen. Auch in seiner eigenen Familie hat er schon viele seiner Lieben verloren. Und in seiner Arbeit als Pfarrer erlebt er noch viel mehr Not und Elend bei den Menschen in seiner Gemeinde.
Ausgerechnet dieser Pfarrer, der so viel Schweres erleben musste, wird zum Liederdichter – und seine Liedtexte rühren bis heute unser Herz an, so dass wir diese Lieder bis heute gerne und aus vollem Herzen singen: Ich singe dir mit Herz und Mund. Paul Gerhardt erinnert uns an das, was wirklich trägt im Leben: Gott, die ewige Quelle, der Brunnen der Gnade. Mit diesem Gottvertrauen dürfen wir durch unser Leben gehen, gerade auch in schwierigen Zeiten. Auch, wenn wir nicht wissen, was morgen kommt. Auch, wenn die Klimaveränderung, deren katastrophale Folgen wir jetzt spüren, uns Angst macht. Auch wenn die lange Corona-Zeit, in der so wenig an menschlichen Begegnungen möglich war, bei uns ihre Spuren hinterlassen hat. Wir dürfen auf Gott vertrauen. So wie die Witwe in der biblischen Geschichte, die selber nicht einmal das Lebensnotwendige hatte, und doch auf die Worte des Propheten Elia vertrauen konnte. So wie Paul Gerhardt in seinem Lied dichtet: „Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht.“ Wir dürfen auf Gott vertrauen – auch und gerade in schwierigen Zeiten. Auch und gerade, wenn wir uns Sorgen machen, wenn das, was wir zum Leben brauchen, nicht einfach selbstverständlich da ist. Und wenn wir dieses Gottvertrauen haben, dann öffnet sich unser Herz. Dann können wir das, was wir haben, auch noch mit anderen teilen, und es reicht für uns alle.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer