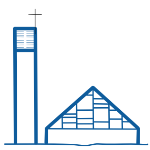Predigt zum 7. Sonntag nach Trinitatis, 3. August 2025
Liebe Mitchristen!
„Ich bin das Brot des Lebens,“ sagt Jesus in unserem Predigttext (Joh 6,30-35). Einen Tag zuvor hatte Jesus 5.000 Menschen satt gemacht, obwohl nur fünf Brote und zwei Fische da waren. „Ich bin das Brot des Lebens.“ Jesus sagt diese Worte zu Menschen, die Hunger haben: Menschen sind hungrig. Sie haben Mangel. Es fehlt ihnen an Nahrung, an Wasser. Sie suchen, sie fragen. Und sie hören: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“
In unserem Gottesdienst erbitten wir heute eine Spende für unser Weltmissionsprojekt im Sudan und Südsudan. Der fortschreitende Klimawandel verschärft die ohnehin schwierigen Lebensbedingungen in diesen Ländern. Der EJW-Weltdienst ermöglicht Menschen im Sudan und Südsudan den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist nicht nur lebenswichtige Grundlage, sondern verbessert die Hygiene und hilft Krankheiten zu vermeiden. Mit IAS (International Aid Service), dem Partner unseres Weltmissionsprojekts vor Ort, werden Brunnen gebohrt, Hand und Solar-Pumpen installiert und Hygieneschulungen durchgeführt. Neben den Brunnen werden christliche Gemeinden unterstützt und Schulen mitfinanziert. Die Mitarbeiter vor Ort tun ihre Arbeit aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es unser Auftrag ist, Gottes Liebe
an andere Menschen in Wort und Tat weiterzugeben.
Auch für Theresa, eine junge Frau aus dem Sudan, haben sich so die Lebensbedingungen verbessert: Theresa sucht sich einen Schattenplatz. Jetzt am Morgen ist die Sonne noch erträglich, im Lauf des Tages wird sie die Erde und die Luft aufheizen, im Sommer nicht selten auf 50 °C. Gerade kommt sie vom Wasserholen zurück. Für ihre Familie braucht sie 40 Liter Wasser für einen Tag. Die vollen Kanister vom Brunnen zu holen, ist zwar immer noch anstrengend, aber seit es den neuen Brunnen im Dorf gibt, ist es kein Vergleich mehr zu früher! Damals war die nächste Quelle einige Kilometer entfernt. Jetzt ist es sogar möglich, dass sie abends noch mal Wasser holt, um ihr jüngstes Kind zu baden.
Menschen brauchen Wasser. Menschen brauchen Nahrung. Auch in unserem Land ist die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten für viele keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Herausforderung. Menschen mit wenig Geld können sich die Lebensmittel im Supermarkt oft kaum leisten. Tafelläden lindern diese Not. Dort können arme Menschen zu vergünstigten Preisen einkaufen. Auch wir als Kirchengemeinde sammeln Spenden für den Tafelladen in Trossingen, die immer donnerstagnachmittags und montagvormittags im Pfarramt abgegeben werden können- jetzt im Sommer noch bis 11. August. Dann macht der Tafelladen Sommerpause, und die Spenden werden erst wieder am 8. September abgeholt. Auch Supermärkte beliefern den Tafelladen- mit Lebensmitteln, die nur noch ein sehr kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum haben, aber trotzdem noch genießbar sind. Nicht alle dieser Lebensmittel landen allerdings im Tafelladen. Viele werden auch einfach weggeworfen- nicht nur aus den Kühlschränken der Supermärkte, auch aus unseren heimischen Kühlschränken.
Was sind unsere Lebensmittel uns wert- unser tägliches Brot? Von einem englischen Journalist wird erzählt, er habe sich mit einem Laib Brot an belebte Straßenecken verschiedener Städte gestellt. Er forderte die Passanten auf, für dieses Brot eine Stunde zu arbeiten. In Hamburg wurde er ausgelacht, in New York von der Polizei festgenommen. Im afrikanischen Lagos wahren mehrere Personen bereit, für dieses Brot drei Stunden zu arbeiten. Im indischen Delhi hatten sich rasch hundert Personen angesammelt. Sie wollten für dieses Brot einen ganzen Tag arbeiten.
Brot haben- zu Essen, zu Trinken, ein Dach über dem Kopf- das sind die menschlichen Grundbedürfnisse. Wir haben das alles, ja die meisten von uns kennen es nicht anders. Gott sei Dank hat es schon lange keine Kriegs- und Hungerzeiten mehr gegeben in unserem Land. Vieles davon nehmen wir für selbstverständlich: Brot- das wesentliche Lebensmittel, das wir oft so gering schätzen. Und doch: Menschen sind hungrig. Hungrig nach mehr als nur nach Brot. Das ist nicht nur bei uns so. Das war auch schon bei den Menschen zur Zeit Jesu so- obwohl die den Hunger nach Brot besser gekannt haben. Trotzdem sind sie Jesus in diese einsame Gegend am anderen Ufer des Sees Tiberias gefolgt, wo es nichts zu essen gab (Joh 6). Warum? Weil sie Hunger nach mehr hatten als nur nach Brot. Denn nicht nur der Körper braucht Verpflegung, sondern auch die Seele.
Nahrung für die Seele- wo finden wir sie? Wir finden sie in Veranstaltungen, wo wir zusammenkommen und unseren Glauben feiern. Ich denke an den ökumenischen Gottesdienst an Pfingstmontag. Oder an das Zeltlager mit den Konfirmanden, auf dem ich vor einigen Wochen war: Zusammen mit 200 anderen Konfirmanden und Mitarbeitern haben wir dieses Wochenende verbracht. Ein Wochenende mit Spiel und Spaß, mit Gebet und Gesang. Ich bin sicher, es wird allen, die dabei waren, in Erinnerung bleiben. Ein Wochenende voller Begegnungen. Begegnungen mit anderen Menschen, Begegnungen mit Gott. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung,“ sagt Martin Buber.
Der Hunger will gestillt sein- nicht nur der Hunger nach Brot. Auch der andere, tiefere Hunger, der Hunger nach Leben- nach wirklichem, erfülltem Leben. „„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ Es ist ein großes Versprechen, das Jesus hier gibt. Ein Versprechen, das uns allen gilt in unseren Hungerzeiten. Ja, manchmal geht es uns so wie den Menschen dort bei Jesus: Da war dieser eine großartige Tag- ein Gottesdienst wie der am Pfingstmontag, oder ein Wochenende wie das Zeltlager mit den Konfirmanden. Und dann am nächsten Tag? Alles geht so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Was ist jetzt mit meinem Hunger nach Leben, nach Sinn? „Wir brauchen wieder so ein Wunder wie gestern, als alle Menschen bei dir satt geworden sind, Jesus!“ sagen die Menschen. „Immer wollen wir satt sein. Nie wieder Hunger haben.“ Jesus verspricht ihnen das nicht. Wir haben keinen Anspruch auf ein langes Leben ohne Hunger, Krankheit und Leid.
Bevor ich nach Wehingen kam, war ich Pfarrerin in Haigerloch. Dort gab es vor dem 2. Weltkrieg eine größere jüdische Gemeinde. Ein Geschäftsmann aus Haigerloch erzählte mir von folgender Begegnung: Er war beruflich viel auf Messen unterwegs und kam dort mit internationalen Kunden in Kontakt. Einmal kam er in diesem Zusammenhang mit einem Kunden ins Gespräch, der ein frommer Jude war. Dieser Jude kannte Haigerloch, und so kamen die beiden Männer ins Gespräch über das schreckliche Schicksal der Juden in Nazi-Deutschland. „Manchmal zweifelt man an Gottes Güte,“ sagte der Geschäftsmann. Sein jüdischer Kunde antwortete ihm: „Nein, an Gottes Güte kann man nie zweifeln. Jeder Tag, den man leben darf, ist ein Geschenk Gottes, ein Grund, Gott zu danken.“ Diese Antwort hat den Geschäftsmann beeindruckt.
Nicht für immer satt sein an Leib und Seele, nie mehr Hunger und Entbehrung- nicht das verspricht uns Jesus Christus. Er lehrt uns zu beten: Unser tägliches Brot gib uns heute. Nur für den heutigen Tag sollen wir bitten, nicht für morgen. Aber Jesus Christus verspricht uns: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ Jesus Christus verspricht: Er macht uns satt. Er gibt uns, was wir brauchen. Nicht immer sofort und nicht immer so, wie wir denken. Aber immer genug. Er legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer