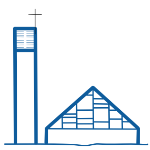Predigt zum Ostersonntag
Liebe Mitchristen!
Die Ostergeschichte mit Maria von Magdala (Joh 20,11-18) ist keine Geschichte in österlichem Jubel und mit Pauken und Trompeten. Da sind keine Osterglocken und ist kein Osterlachen zu hören. Es ist eine leise und verhaltene Geschichte – die Geschichte einer Frau, die berührt wird von einer anderen Wirklichkeit als der, die direkt vor Augen liegt, und die so eine Wende in ihrem Leben erfährt. Maria steht draußen vor dem Grab Jesu. Der Schreck von heute Morgen sitzt ihr immer noch in den Knochen: Das Grab Jesu ist ganz offensichtlich geschändet worden. Kein Stein steht dort mehr auf dem anderen. Der große Stein vom Eingang ist weggewälzt, und das Grab ist leer. Erschrocken läuft sie zu den Jüngern und berichtet ihnen: „Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Petrus und Johannes laufen zum Grab. Sie finden es leer und gehen wieder heim. Da ist wohl nichts zu machen – der Leichnam ist gestohlen worden.
Maria von Magdala gibt sich damit nicht zufrieden. Sie bleibt, auch wenn es eigentlich keinen Sinn hat. Sie braucht diesen Ort, dieses Grab, auch wenn dort nichts mehr ist, wie es war. Eine Frau, die einen Ort sucht für ihre Trauer, für die es eigentlich keinen Ort mehr gibt. Die Trauer braucht einen Ort – das Grab, das die sterblichen Überreste des geliebten Menschen birgt. Für viele Menschen ist das Grab der Ort, an dem sie sich ihrem Verstorbenen am nächsten fühlen. Hier sind sie ungestört. Hier dürfen sie ihren Gefühlen, ihren Tränen freien Lauf lassen. Hier halten sie Zwiesprache mit ihrem Verstorbenen.
Manche Menschen brauchen ein solches Grab nicht für die Trauer um ihren Verstorbenen. Sie haben andere Orte: Das Bild im Wohnzimmer mit der brennenden Kerze davor, der Ort am Straßenrand, an dem der schreckliche Unfall geschah, die Bank im Wald, auf der man sich nach dem Spaziergang immer gemeinsam ausgeruht hat – damals, in den guten Tagen. Aber einigen fehlt das Grab dann doch. Hilflos und heimatlos stehen sie vor der großen grünen Wiese auf dem Friedhof, von der sie wissen: Dort ist es. Irgendwo auf dieser Fläche ist mein geliebter Verstorbener bestattet, anonym, wie viele andere auch. Wohin nun mit meiner Trauer? Wenn es doch wenigstens einen Platz gäbe für einen kleinen Blumenstrauß für den geliebten Menschen, um den ich trauere. Trauer braucht einen Ort. Trauer lässt sich auch nicht einfach abhaken und zu den Akten legen. Trauer braucht auch Zeit.
Maria von Magdala geht nicht weg vom Grab, weil sie diesen Ort braucht, das Grab Jesu. Sie versteht nicht was geschehen ist. Sie ist aufgewühlt. Ihre Gedanken und Gefühle überstürzen sich. So kann sie hier nicht einfach wieder weggehen, das geht nicht. Ihr geht das alles viel zu schnell. Sie braucht Zeit, um mit der neuen Situation klarzukommen. Sie denkt an Jesus, an das, was er ihr bedeutet hat, welche Wende sich in ihrem Leben vollzogen hat durch ihn. Quälende Geister hatte Jesus von ihr ausgetrieben. Von Ängsten, Zweifeln und Schmerzen hatte er sie befreit. Er hatte sie verwandelt und von einer unbekannten namenlosen Frau zu seiner Jüngerin und Begleiterin gemacht. Er hatte ihr Heilung, Kraft und Hoffnung gegeben. Sie war glücklich und lebendig gewesen. Wie nahe war sie ihm gewesen in all diesen Jahren. Nun das Ende, dieses schreckliche Aus und Vorbei. Und mit ihm, mit ihrem Jesus, ist ihre Lebenskraft, ihr Mut und ihre Hoffnung mitgestorben. Tot und leer fühlt sie sich, hier an diesem leeren Grab, das nicht einmal mehr den Leichnam Jesu birgt. Nichts ist mehr übrig geblieben von ihm, nichts.
Endlich kann Maria weinen. Sie steht draußen vor diesem leeren und sinnlos gewordenen Grab und weint. Die ganze Zeit hat sie ihre Tränen zurückhalten können: Als sie ihn verhaftet hatten. In den bangen Stunden, die seinem Urteil voraus gingen. Als es dann feststand, das Urteil: Kreuzigung, die Höchststrafe, diese grausamste aller Todesarten. Als er dort am Kreuz hing und litt und starb. Als er tot war und sie ihn vom Kreuz abnehmen und begraben durften. Jetzt erst, jetzt endlich kann sie weinen um ihn. Ihre Tränen lösen sie aus ihrer Erstarrung. Ihre Tränen bringen sie in Bewegung. Sie bückt sich hinunter und schaut in das Grab. Ihr Verstand sagt ihr: Es hat keinen Sinn, das zu tun. Sie aber folgt ihrem Gefühl, ihren Tränen. Durch die von Tränen verschleierten Augen fällt ihr Blick ins Grab. Mit diesen Augen sieht sie mehr als die beiden Jünger vorhin wahrgenommen haben, mehr als nur die erschreckende Leere dieses Grabs. Ihr Blick geht tiefer. Er wandelt sich vom Sehen zum Schauen. Sie nimmt jetzt wahr, dass sie nicht allein ist. Sie kann jetzt die beiden Engel erkennen. Sie sind genau dort, wo Jesus gelegen hat. Zwei Engel sind da. Es ist nicht wichtig, wie sie aussehen. Wir erfahren dazu fast nichts in dieser Geschichte. Nur von weißen Gewändern ist die Rede, das ist alles. Etwas anderes ist wichtig an diesen Engeln, etwas, das auch wir heute erleben können, und dazu braucht es nicht einmal weiße Gewänder. Engel in meinem Leben zu erfahren, das bedeutet zu erfahren: Jemand ist da für mich. Jemand sieht, wie es mir geht, und nimmt Anteil daran, spricht mich darauf an: Frau, was weinst du? Jemand nimmt sich Zeit für mich und hört sich mein Elend an – auch wenn es immer wieder dieselbe Geschichte ist, die ich erzähle: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Auch als auf einmal dieser Friedhofsgärtner oder wer immer es ist hinter ihr steht, erzählt Maria von Magdala wieder dieselbe Geschichte, noch dringlicher, noch entschlossener sogar: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen. Sie will wirklich alles geben, um seinen toten Körper wieder zu finden. Sie erinnert mich an die Mütter und Frauen in so manchen Unrechtsstaaten, die nicht nachlassen, ihre verschwundenen Angehörigen zu suchen. Wenigstens das, was man „sterbliche Überreste“ nennt, wollen sie zurückerhalten.
Maria von Magdala muss ihren Blick vom Grab und von den Engeln abwenden, um mit diesem für sie fremden Mann ins Gespräch zu kommen. Sie wandte sich um, heißt es in der Bibel. Sie hat ihre Blickrichtung geändert. Eben war sie noch gebückt und gekrümmt. Ihr Blick war gesenkt, in das Grab hinein. Nun wendet sie sich um und blickt auf. Nun nimmt sie nicht mehr den Tod, sondern das Leben in den Blick. Doch Maria von Magdala erkennt diese Wende in ihrem Leben zunächst nicht. Sie erkennt nicht, dass es kein Fremder ist, der da vor ihr steht, sondern Jesus. Sie steht direkt vor ihm und doch ist es, als stünde sie immer noch abgewandt. Sie muss sich auch innerlich auf diese neue Perspektive einstellen. Auch innerlich muss sie sich noch vorm Grab abwenden, von der Sorge um den Toten, die ihren Blick trübt und sie nicht erkennen lässt, dass es Jesus selbst ist, der da vor ihr steht, leibhaftig und lebendig. Und so steht in der Bibel ein zweites Mal geschrieben: Da wandte sie sich um. Keine äußerliche, körperliche Wende ist damit gemeint, sondern eine innerliche, seelische Wende. Maria von Magdala wendet sich ab von dem Gedanken, Jesus weiter bei den Toten suchen zu müssen. Sie wendet sich dem unfassbaren Gedanken zu, Jesus könnte doch am Leben sein, nicht nur theoretisch und irgendwo, sondern hier und jetzt, direkt neben ihr. Jesus, der ihr Leben gewendet hatte am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit. Er ist wieder da. Er vollzieht diese neue, endgültige Wende im Leben von Maria von Magdala: Vom Gebeugtsein zum aufrechten Gang. Von der Verzweiflung zur Hoffnung. Vom Suchen nach dem Toten zur Gewissheit: Er lebt!
Diese Wende wird möglich, weil Jesus sie bei ihrem Namen ruft: Maria. Daran erkennt sie ihn, an dieser persönlichen Zuwendung zur ihr: Maria. Mehr sagt Jesus nicht. Mehr Worte braucht es nicht: Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Maria gibt ihre persönliche Antwort auf diese Zuwendung des Auferstandenen: Rabbuni, sagt sie, mein Herr und mein Meister, mein Befreier, meine Hoffnung, mein Leben. Alles legt sie in dieses eine Wort hinein: Rabbuni. Freude steigt in Maria auf, und das Verlangen danach, das Unfassbare zu erfassen, zu begreifen, mit ihren eigenen Händen: Jesus lebt. Er ist es wirklich. Jesus aber sagt zu ihr: Rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Jesus ist auf einem Weg, auf dem man ihn nicht festhalten kann.
Wie soll sie nun damit umgehen, mit all diesen beglückenden und doch auch verwirrenden Erfahrungen. Jesus gibt ihr einen Auftrag. Er schickt sie zurück ins Leben. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria geht. Jetzt kann sie den Ort des Todes und der Trauer hinter sich lassen. Jetzt kann sie die Osterbotschaft weitersagen.
Es ist vieles schwer zu begreifen im Grenzbereich von Leben und Tod. Das ist auch nach Ostern so. Aber die Botschaft, mit der Maria geht, ist hell und klar: Der Auferstandene ist uns vorausgegangen. Er erwartet uns. Sein Gott ist der Gott aller. Der Weg zu ihm ist frei. Auch der Tod kann ihn nicht verschließen. Maria ist davon bewegt. Sie geht und verkündigt, was sie erfahren hat: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Tragen auch wir diese Osterbotschaft weiter: Jesus lebt!
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer