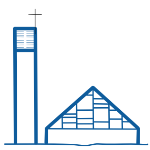Predigt zum Sonntag Judika, 21. März 2021
Hiob 19, 19-27: Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich liebhatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die Hand Gottes hat mich getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen! Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.
Liebe Mitchristen!
Hiobsbotschaften – die kennen wir alle in diesen Tagen: Die Infektionszahlen steigen an, die britische Corona-Mutation verbreitet sich weiter, Impfstoff-Liefertermine können nicht eingehalten werden, ein Impfstoff musste zeitweise aus dem Verkehr gezogen werden. Hiobsbotschaften, das sind schlechte Nachrichten. Woher kommt dieses Wort eigentlich? Es kommt aus der Bibel. Die Bibel erzählt von Hiob. Der war ein gläubiger und rechtschaffener Mann, der nichts Unrechtes getan hat. Einer, der es wirklich verdient hätte, dass er mit seiner Familie in Frieden und Freude sein Leben verbringen kann. Er war verheiratet, hatte sieben Söhne und drei Töchter, und ein großes landwirtschaftliches Unternehmen mit zahlreichen Angestellten und vielen tausend Stück Vieh.
Wenn da nur nicht diese Hiobsbotschaften gewesen wären. Eine schlechte Nachricht nach der anderen bringen diese Boten: Zuerst ist es ein Raubüberfall. Alle Rinder und Esel sind gestohlen worden, die Hirten sind tot. Dann eine verheerende Feuersbrunst. Alle Schafe sind verbrannt, die Hirten sind tot. Dann ein feindlicher Angriff. Alle Kamele sind in Feindeshand, die Hirten sind tot. Hiobs ganzer Besitz ist auf einen Schlag weg, alle seine Angestellten sind getötet worden. Doch damit nicht genug. Es kommt noch ein Bote, der eine Hiobsbotschaft bringt: All deine Söhne und Töchter waren zusammen, um zu feiern. Da kam ein Wirbelsturm, und das Haus ist eingestürzt. Sie sind alle tot. So sagt es dieser Bote zu Hiob. Alles weg, alles verloren hat Hiob. Nicht einmal seine Gesundheit bleibt ihm. Hiob wird krank. Sein ganzer Körper ist von Geschwüren bedeckt. Auch seine Frau ist ihm keine Hilfe mehr: „Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb!“ So redet sie mit ihm.
Zum Glück hat Hiob noch Freunde. Drei Freunde kommen ihn besuchen, um mit ihm zu trauern und ihn zu trösten. Ich denke, es müssen wirklich gute Freunde sein, dass sie das machen. Oft machen wir ja einen Bogen um die Menschen, die vom Unglück getroffen sind. Wir wollen nicht daran erinnert werden, dass uns ein so schlimmes Schicksal auch treffen könnte. Und wir sind unsicher: Wie sollen wir mit Jemandem umgehen, der so viel Schweres erlebt hat? Was sollen wir sagen? Ist nicht alles, was wir sagen können, nur billiger Trost, der den Schmerz nur vergrößert? Die Freunde von Hiob kommen ihm nicht mit billigem Trost. Sie halten das Elend mit ihm aus. Sie weinen mit ihm. Sie ertragen es, dass ihnen die Worte fehlen. Sieben Tage und sieben Nächte sitzen sie mit ihm auf der Erde und schweigen. Das beeindruckt mich an diesen Freunden.
Hiob selbst ist es, der dieses lange Schweigen bricht. Harte Worte sind es, die aus seinem Mund kommen. Hiob verflucht den Tag, an dem er geboren wurde. Warum bin ich nicht bei meiner Geburt gestorben? fragt er. Dann wäre mir dieses ganze Elend erspart geblieben. Das ist dann doch zu viel für Hiobs Freunde. Jetzt halten sie es nicht mehr aus. Jetzt können sie nicht mehr ruhig bleiben. Jetzt packen sie aus und machen Hiob Vorwürfe. Hiob soll doch mal überlegen, ob er nicht selber Schuld ist an seinem Unglück. Ein heftiger Wortwechsel. Es fliegen die Fetzen zwischen den Freunden. Die Freunde, die eigentlich gekommen sind, um Hiob zu trösten, wenden sich gegen ihn. Hiob fühlt sich von ihnen angegriffen und verletzt.
Was bleibt Hiob jetzt noch? Es bleibt ihm sein Glaube an Gott. Gott, der ihm nicht geholfen hat, der all dieses Elend nicht verhindert hat. Wie kann Hiob da noch an seinem Glauben festhalten? Aber Hiob wirft seinen Glauben an Gott nicht über Bord. Er hält fest an diesem Glauben, auch wenn er Gott nicht verstehen kann: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“
Nur weil er mit Gott kämpft, kann Hiob schließlich diese Worte sagen. Nur so kann er an seinem Glauben festhalten. Jetzt in der Passionszeit denke ich an Jesus. An seinen Glaubenskampf im Garten Gethsemane, wo er Gott bittet, den Kelch des Leidens an ihm vorübergehen zu lassen. Auch Jesus wird von seinen Freunden im Stich gelassen. Wie Hiob bringt er seine Klage vor Gott, seine Todesangst, sein Elend und seine Zweifel. Wie Hiob kämpft Jesus mit Gott. Und wie Hiob erlebt er: Gott segnet den, der mit ihm kämpft. Das Gebet Jesu im Garten Gethsemane ändert sich so wie die Klage von Hiob: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Gott. So kann Jesus sein Gebet beschließen. So kann er mit neuem Vertrauen seinen Weg gehen, den Weg ins Leiden und ans Kreuz.
Was auch immer kommt, Gott ist bei mir. Auch wenn ich mein Leben nicht verstehe. Auch wenn ich diese Welt nicht verstehe. Ja, auch dann, wenn ich Gott nicht verstehe. Das möchte ich gerne lernen, von Hiob und von Jesus. Den Glauben nicht über Bord werfen in schwierigen Zeiten, sondern Dranbleiben am Glauben, mit Gott kämpfen. Ich bin nicht Hiob, und schon gar nicht Jesus. Aber Gott sei dank ist ihre Rede aufgeschrieben, so wie Hiob es sich gewünscht hat. So kann ich sie immer wieder nachlesen und nachsprechen. So kann ich mich festhalten an diesen Worten. In all den Hiobsbotschaften unserer Zeit brauche ich solche Worte. Worte, die den Hiobsbotschaften etwas entgegensetzen. Worte, die tragfähig sind auch in schwierigen Zeiten: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer