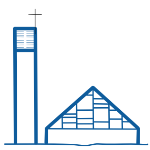Predigt zum Sonntag Estomihi, 19. Februar 2023
Liebe Mitchristen!
„Liebe wird immer da sein“. So heißt der Titel eines Bildes, gemalt von einem Mann namens Bayram. Ein romantisches Bild ist das. Zu sehen sind zwei Schwäne, die sich an der Brust zärtlich berühren und deren Köpfe einander liebevoll zugeneigt sind. Die geschwungenen Hälse der beiden Schwäne bilden die Form eines Herzens. Am Himmel steht der Mond. Er bescheint die liebenden Schwäne und lässt ihr Spiegelbild im Wasser erscheinen.
„Liebe wird immer da sein“ – das ist eine steile Aussage, gerade in unserer Zeit, in der viele Ehen scheitern und viele Menschen unter der Einsamkeit und Lieblosigkeit leiden, die sie umgibt. Wäre es da nicht passender, etwas vorsichtiger zu formulieren, zum Beispiel: „Liebe sollte immer da sein“? Hören wir, was der Apostel Paulus in 1. Kor 13 über die Liebe schreibt:
„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
„Die Liebe hört niemals auf“, so heißt es da bei Paulus. Alles andere wird an ein Ende kommen – alles, auf das wir heute große Stücke halten. Wenn einer gut reden kann und die anderen mit Worten überzeugen – ohne die Liebe ist das alles bloß viel Lärm um nichts. Wenn einer intelligent ist und neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnt – ohne die Liebe ist das bloß, als ob der die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Wenn einer fest im Glauben steht und sozial engagiert ist – ohne die Liebe ist das bloß Fanatismus oder nur Mittel zum Zweck, um vor anderen besser dazustehen, ganz nach dem Motto: Gutes tun und darüber reden.
Die Liebe ist frei von solchen Hintergedanken und erwünschten Nebeneffekten. Da geht es nicht darum, dass ich selber groß rauskomme und gut dastehe. Da geht es um den anderen, um meinen Mitmenschen, der mir wichtig ist. Ja, da geht es sogar um die, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben wollte. „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel“ (Mt 5,44). So hat Jesus es uns aufgetragen. Es ist ein schwerer Auftrag, einer der uns immer wieder herausfordert und doch auch immer wieder scheitern lässt. Ähnlich schwer erscheint es, die Liebe so zu leben, wie Paulus sie den Korinthern nahe legt: „Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ Wer kann dem gerecht werden? Wer schafft das, die Liebe so zu leben, wie sie hier beschrieben wird?
Es gibt nur einen, der das geschafft hat, die Liebe so zu leben. Jesus Christus hat die Liebe gelebt bis zum Ende. Er hat alles ertragen und erduldet, indem er ans Kreuz gegangen ist für uns – allein aus Liebe. Das ist die Liebe, die immer da sein wird. Diese Liebe ist vollkommen. Die Liebe, die wir auf dieser Welt erleben dürfen, ist ein Abglanz dieser Liebe. Es ist etwas Wunderbares, wenn zwei Menschen ihren Weg durch das Leben gemeinsam gehen. Immer wieder erzählen mir Paare, über welch ungewöhnliche und verschlungene Wege sie zueinander gefunden haben oder welch schwere und krisenreiche Zeiten sie miteinander durchgestanden haben. Welch ein Wunder ist es, wenn die Liebe zweier Menschen tragfähig wird und bleibt. Welch ein Wunder ist es überhaupt, dass wir Menschen einander Liebe geben können, in der ganzen Vielfalt von Beziehungen, durch die wir miteinander vernetzt sind. Egal, in welcher Lebensform wir leben, wir alle brauchen Liebe, vom kleinen Baby bis zum Hochbetagten.
Die Liebe ist ein Geben und Nehmen, und sie ist lebensnotwendig. Und doch ist sie unvollkommen. Sie ist nur ein schwacher Abglanz der göttlichen Liebe, wie eine Wasserspiegelung in einem Teich. Wir erkennen nur die Umrisse, vieles bleibt unklar und verschwommen, wie das Spiegelbild der Schwäne auf dem Bild. Der Himmel hängt nicht immer voller Geigen, er ist oft dunkel und bedrohlich, wie ihn der Maler hier darstellt – eine schier undurchdringliche Finsternis, die das Mondlicht auch nicht aufhellen kann. Nicht sanft und golden steht der Mond hier am Himmel, sondern in kaltem, harten Weiß, das den Kontrast zwischen dem schwarzen Himmel und den weißen Schwänen beinahe gespenstisch anmuten lässt. Es ist eine harte und dunkle Welt, aus der der Künstler mit seinem Bild zu uns spricht. Bayram hat das Bild gemalt, als er im Gefängnis war. Die Straftäter haben Bilder gemalt, in Zusammenarbeit mit einer Kunsttherapeutin. Aus den Bildern ist ein Kalender entstanden. Durch meine Arbeit als Gefängnisseelsorgerin habe ich diesen Kalender kennen gelernt. Ich kenne nur den Kalender. Die Menschen, die die Kalenderbilder gemalt haben, kenne ich nicht. Aber aus meiner Arbeit mit Gefangenen in Rottweil weiß ich, wie wichtig es für diese Menschen ist, einen ehrlichen Blick auf ihr eigenes Leben werfen zu können. Vieles ist schiefgelaufen in ihrem Leben. Sie brauchen eine Neuorientierung. Oft fällt es diesen Menschen schwer, über die dunklen Punkte in ihrem Leben zu reden, über die eigene Schuld und das eigene Versagen. Bilder sagen oft mehr als Worte. Manches, das man in Worten nur schwer ausdrücken kann, lässt sich in einem Bild darstellen: Gedanken und Gefühle, Hoffnungen und Wünsche, Irrwege und Auswege.
„Liebe wird immer da sein.“ So nennt Bayram sein Bild. Wer im Gefängnis sitzt, hat in der Regel andere Erfahrungen gemacht. Die Erfahrung, dass Gewalt an die Stelle der Liebe tritt – Gewalt, die sich nicht ungeschehen machen lässt, weil sie ihre Spuren hinterlassen hat: Wunden und Narben, nicht nur am Körper, sondern auch an der Seele. Ich verstehe Bayrams Bild als ein Bild gegen alle Erfahrung, der Erfahrung zum Trotz: Die Liebe, die trotz allem da ist, trotz der Dunkelheit, die sie umgibt.
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Die Liebe ist die größte, sagt Paulus. Sie ist der Ausgangspunkt für Glaube und Hoffnung: Der Glaube glaubt, dass die Liebe in der Dunkelheit unserer Welt da ist, auch da, wo wir sie nicht erkennen. Die Hoffnung hofft, dass die Liebe die Dunkelheit unserer Welt durchdringen wird. Liebe wird immer da sein, denn Gott selbst ist die Liebe. Gott hat um die Dunkelheiten unserer Welt nicht einen großen Bogen gemacht. Er selbst hat Gewalt und Unrecht erlitten. Jesus Christus ist unschuldig verurteilt worden zum Tod am Kreuz. Nicht mit Gewalt hat er reagiert auf diese Gewalt, die ihm angetan wurde, sondern mit Liebe. So konnte er sagen: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Die Liebe ist stärker als die Gewalt. Das ist die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung. Das ist unser christlicher Glaube, unsere christliche Hoffnung. Es ist ein Glaube und eine Hoffnung oft gegen allen Augenschein, immer in dem Wissen, dass alles Stückwerk ist, was wir hier in dieser Welt erleben. Und doch dürfen wir immer wieder erleben, dass Liebe da ist, wo wir sie nicht erwarten. Oft sind es nur kleine Gesten, die doch so viel bewirken können: Ein paar freundliche Worte, die die Einsamkeit vertreiben. Die Hand, die zur Versöhnung ausgestreckt ist. Ein gutes Wort, das Trost spendet in schweren Zeiten. All das sind Zeichen von Gottes Liebe – Zeichen, die wir selbst setzen können – bis wir einst in Gottes Vollkommenheit sein werden und das Stückwerk aufhören wird.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer